Das Beispiel Amanda Hocking zeigt, wie sich im anglo-amerikanischen Markt derzeit die Verlagswelt und die Selbstverlegerwelt immer stärker annähern. Wie wird die Welt für Autoren in Zukunft aussehen?
Manchmal macht es richtig Spaß, zufällig ein neues Blog zu entdecken, das man sofort abonniert: Weil es gut und hochinformativ geschrieben ist und zum Nachdenken bringt. The Book Deal Blog ist so eins – sein Autor Alan Rinzler kein unbeschriebenes Blatt: Der heutige Cheflektor arbeitete für Verlage wie Schuster & Schuster oder Bantam Books und brachte Autoren wie Toni Morrison oder Tom Robbins heraus. Sein Blog richtet sich an Autoren und andere Buchmenschen, die sich für die „seltsamen“ Wege interessieren, auf denen Bücher veröffentlicht werden, und gibt wertvolle Tipps, wie man einem Manuskript auf die Welt verhelfen kann. Spannend ist dabei, dass er die großen Umwälzungen in der Branche und alternative Wege genau beobachtet und öfter Co-Autoren einlädt, die auch nicht von Pappe sind.
Eine Perle solcher Differenzierungskunst ist sein letzter Beitrag: Advice for Amanda Hocking from Authors and Agents – ein Beitrag, den man mitsamt den Kommentaren genau lesen sollte. Auch wenn man sich überhaupt nicht für Amanda Hocking interessiert.
Tellerwäschermärchen – wer hat recht?
Wir erinnern uns: Amanda Hocking ist die junge Amerikanerin, die im Eigenbau und per Kindle-E-Books mit Vampirromanen zur Millionärin wurde und sich nun für einen Vier-Buch-Vertrag vom renommierten Verlagshaus St. Martin’s Press hat kaufen lassen, wofür sie 2 Millionen Dollar kassierte. Und sie war schlau: Sie hat nämlich darauf bestanden, neben den vertraglich festgelegten Büchern weitere im Selbstverlag zu schreiben und ihre gesamten E-Rechte zu behalten. Ihr Grund, zu einem Verlag zu gehen, lag auf der Hand. Sie erhofft sich neue Käuferschichten jenseits der E-Book-Szene, eine perfekte Werbe- und Lektoratsmaschinerie, das „Qualitätslabel“ Verlag und vor allem endlich jede Menge Zeit zum Schreiben. In den USA hat das zu großen Diskussionen geführt, weil einige Millionenseller genau den anderen Weg gehen: Joe Konrath, Barry Eisler und Bob Mayer etwa stiegen bei ihren Verlagen aus (ich berichtete mehrfach im Blog) – und auch ihre Argumente können sich sehen lassen.
Warum ist Alan Rinzlers Beitrag nun so lesenswert? Hier sagen etablierte und Indieautoren ihre Meinung, Agenten und Menschen aus der Buchbranche. Ergebnis ist eine Welt, die sich nicht in Schwarz und Weiß teilen lässt, in der Entscheidungen über die Art des Verlegens auch vom Typ des Schreibenden abhängig sind, in der man auf beiden Seiten scheitern oder berühmt werden kann. Vor allem aber räumt die differenzierte Abbildung unterschiedlicher Meinungen auf mit Buchbranchenmythen.
Autoren- und Verlagsmythen
Kann man mit einem Verlag wirklich die Hände in den Schoß legen und endlich nur noch schreiben? Bestsellerautor Garth Stein sagt, mit einem Verlag fange die Arbeit erst richtig an – Amanda Hocking wird womöglich noch härter als bisher schuften müssen. Denn eine Werbebteilung im Verlag entbinde den Autor nicht von zunehmend größeren Eigenmarketing-Verpflichtungen. Tom Robbins ist froh, heutzutage nicht mehr als Newbie anfangen zu müssen, denn der Markt ist für neue und unbekanntere Autoren erschreckend viel härter geworden. Kritische Stimmen fragen sich, ob sich der Verlag mit dem Millionendeal nicht überhoben hat – er wird seine Bücher nicht zu Ausverkaufspreisen à la Hocking anbieten können. Werden da wirklich so viele neue Fans im Print nachwachsen? Lesen! Die Meinungen sind so vielfältig, dass man ein gutes Bild über den modernen Verlagsbetrieb bekommt.
Spitzentitel oder Altpapiertapete?
Und der unterscheidet sich in vielen Punkten im deutschsprachigen Raum gar nicht mehr so sehr vom US-Markt. Konzernverlage (Betonung auf Konzern, es gibt auch andere) selektieren ihre Autoren nach genau den gleichen Maßstäben: Gekauft werden weniger Geschichten, sondern vermarktbare Persönlichkeiten; Autoren, die entweder schon einen Rattenschwanz an Fans mitbringen oder bereit sind, zur Personality-Show zu werden. Gekauft wird immer weniger Midlist, sondern entweder Trendmaterial, das sich mit wenig Aufwand zum Spitzentitel machen lässt – oder sogenannte „Altpapiertapete“. So nennt man in Insiderkreisen die Bücher von einem Heer von austauschbaren, unbekannten einheimischen Beta-Autoren, die man braucht, um die Trendtitel zu unterfüttern; um zu zeigen, dass der Verlag ein riesiges Programm hat. Das sind die Bücher, die am schnellsten im Ramsch landen, weil sich Programmbedürfnisse alle halbe Jahre ändern. Es ist ein Haifischbecken – und dafür muss man gemacht sein. Schreiben allein reicht schon lange nicht mehr.
Nachwehen des Outsourcings
Hat man es dann geschafft, hat man keinesfalls alles vom Hals, was ein Selbstverleger allein oder mit Hilfen leisten muss. Wohl dem, der auf Anhieb eine vernünftige Lektorin zugeteilt bekommt. In meinem Kollegenkreis nehmen die Klagen in den letzten drei Jahren massiv zu: Viel zu oft wechselt auch bei Hausautoren die Lektorin, Newbies geraten an Anfänger und Praktikanten, die outgesourcten Kräfte arbeiten teilweise frustriert unter einem enormen Leistungsnachweis-Druck, den sie an die Autoren weitergeben. Wenn nämlich ein Manuskript heutzutage rot gesprenkelt aussieht, als sei ein Huhn darüber gelaufen, liegt das nicht mehr zwingend an einem schlechten Text. Freie Lektoren müssen in manchen Verlagen für ihre Existenzberechtigung Textbearbeitung nachweisen. Weil aber Autoren immer druckfertiger schreiben können müssen, wird dann eben einfach etwas hineinkorrigiert. „Lehnen Sie die Korrekturen ruhig ab“, bekommt man dann manchmal gesagt, „ich muss sie einfach vorzeigen.“ So braucht es einen kaum zu wundern, wenn auch in Deutschland bekannte Autoren ihren Leib- und Magen-Lektoren bei deren Jobwechsel in andere Verlage folgen oder vertraglich darauf bestehen, ihre eigene Lektorin mitbringen zu können. Amanda Hocking jedenfalls hätte sich mit ihren Millionen längst eine eigene Spitzenlektorin leisten können!
Und wenn man dann alles selbst macht, weil man sowieso so viel selbst machen muss? Der Markt der Selbermacher befindet sich in einer gigantischen Wachstumsphase. Sogar etablierte Verlage investieren kräftig in den Dienstleistungsmarkt (z.B. neobooks, epubli). Wer jedoch glaubt, wie im Hocking-Märchen schnell auf eigene Kappe berühmt werden zu können, der irrt. Wer glaubt, es genüge, sich von Vorgaben der Verlagswelt zu befreien, um ganz groß rauszukommen, der träumt. In einem Massenmarkt, in dem es keinerlei etablierte Qualitätskriterien mehr gibt, nur noch Lesermeinungen und Leserverhalten, ist das Haifischbecken nicht dünner besiedelt – im Gegenteil. Einzelne Autoren sind zunächst kleine unbekannte Nümmerchen. In einer Welt, in der jeder schreiben will, wachsen für jeden gestrauchelten Autor hundert andere nach.
Ein einziges Haifischbecken für zu viele Autoren?
Das ist das interessante an Alan Rinzlers Beitrag – Er zeigt, wie sich im anglo-amerikanischen Markt derzeit die Verlagswelt und die Selbstverlegerwelt immer stärker überschneiden, teilweise sogar annähern. Es gibt kein klares Entweder – Oder mehr für Autoren. Es gibt nur noch drei wichtige Fragen: Was will ich schreiben, was will ich erreichen und auf welchem Weg bringe ich mein Werk am nachhaltigsten an die Leser? Harte Maloche und ein Leben fast ohne Freizeit verlangen beide Wege. Hartnäckigkeit, Durchhaltevermögen, Disziplin, einen starken Charakter und eine gewisse Unempfindlichkeit brauchen verlegte wie selbstverlegende Autoren – ganz abgesehen vom Können und vom Talent. Illusionen und falsche Vorstellungen sind auf beiden Seiten tödlich. Es gibt längst kein „besser“ oder „schlechter“ mehr – die Verlagswelt scheint sich zu einer Welt der Großfabriken und der individuellen Wege zu entwickeln. Gehätschelt wird kaum noch, entwickelt immer weniger, aufgebaut nur in Ausnahmefällen. Selbst ist der Autor – auch im Verlag.
Ich persönlich glaube, dass sich die Autorenschaft in Zukunft ähnlich teilen wird, wie man das im Berufsleben mit Angestellten und Freiberuflern oder Unternehmern hat. Die einen brauchen ein Mindestmaß an festen Strukturen und jemanden, der einem sagt, was man zu tun hat, wo es lang geht. Sie brauchen die vermeintliche Sicherheit (Arbeitslosigkeit kann man ja ausblenden). Die anderen werden sich eher als Ein-Mensch-Unternehmung wohlfühlen, werden Freude an vielfältigen und wechselnden Aufgaben haben, Freude am Umgang mit Menschen. Die Mutigen, die mit der inneren Risikobereitschaft und dem Überblick über das Ganze sind für einen Ausstieg eher gemacht als Nur-Schreiber. Mutig müssen sie sein, denn noch gibt es außer bei Crowdfunding wenig Konzepte, um die eigene Buchproduktion fremdzufinanzieren. Ein Verlag zahlt im Idealfall eine Garantiesumme als Vorschuss und finanziert alles rund ums Buch.
Egal, welchen Weg sie einschlagen – beide Sorten von Schriftstellern schwimmen in genau dem gleichen Pool: Er ist überfüllt von Büchern, umringt von zunehmend übersättigten Lesern. In diesem Pool herrscht derzeit extrem hoher Wellengang und keiner weiß, ob und wann neue Medien und neue Techniken zum Tsunami werden. Nur eines ist gewiss: In diesem Pool begegnet man eher dem weißen Hai als der Zauberfee mit dem Millionendeal. Nach dem großen „Ich schreibe auch ein Buch“-Hype wird womöglich das große Autorensterben kommen?
Petra van Cronenburg studierte Theologie und Judaistik mit den Schwerpunkten Religionswissenschaften und Kirchengeschichte in Tübingen und absolvierte eine Volontariatsausbildung zur Redakteurin. Sie lebt heute als freie Journalistin, Buchautorin, Texterin und Übersetzerin in Frankreich.
Der Artikel ist zuerst im Blog von Petra van Cronenburg erschienen. Hier die Webseite der Autorin.











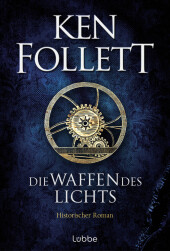
Kommentar hinterlassen zu "Petra van Cronenburg: Ein Haifischbecken für alle?"