
Medienübergreifendes Erzählen stellt Buchverlage vor Herausforderungen, die Vertreter der Film- und Gamesbranche längst gemeistert haben. Wie interaktive Geschichten den Schreibprozess und das Rollenverständnis für Autoren verändern, erläutert Games-Autor Martin Ganteföhr (Foto) im Gespräch mit buchreport.de. Er tritt am 12. Oktober 2011 zum Thema „Transmediales Storytelling“ bei der Konferenz Storydrive der Frankfurter Buchmesse auf (hier das Programm).
Was unterscheidet den herkömmlichen Buch-Autor vom Interactive Writer?
Ganz fundamental gesprochen: die Einbeziehung des Nutzers als handelnde Instanz. Interaktive Geschichten geben Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten, sie bieten verschiedene Erzählpfade an, oder die optionale Vertiefung bzw. Ausweitung einer Geschichte. Das alles muss natürlich geschrieben werden und in allen denkbaren Kombinationen ein dramaturgisch sinnvolles Ganzes ergeben. Für die konkrete Arbeit hat das sehr unterschiedliche, scheinbar sogar widersprüchliche Folgen: Die Arbeit ist einerseits spielerischer, denn viele „Was-wäre-wenn“-Gedanken können – oder müssen – tatsächlich umgesetzt werden. Andererseits ist Interactive Writing viel stärker abhängig von Planung und Strukturen, denn interaktive Erzählungen können zu gigantischen Konstrukten ausarten, von denen ein Spieler aber nur einen Bruchteil erleben wird. Umso wichtiger ist es, einen Überblick zu behalten.
Sie haben ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht. Warum haben Sie für die Darstellung Ihrer Geschichten das Medium Computerspiel und kein traditionelles Medium gewählt?
Da gab es keine bewusste Entscheidung – der Brancheneinstieg hat sich während des Studiums ergeben. Mitte der Neunziger Jahre erfuhren interaktive Medien generell, auch gesellschaftlich, einen großen Schub, nicht zuletzt durch die Freischaltung des World Wide Web. Hypertext, Hyperfiction, Multi- und Hypermedia, Fragen zur Autorenschaft – all das war damals auch an den Universitäten ein großes Thema. Die Parallelen zum klassischen Schreiben waren offensichtlich, und die Literaturtheorie befasste sich, beispielsweise im Bereich der mündlichen Überlieferungen, schon lange mit veränderlichen, „interaktiven“ Geschichten. Insofern war der Schritt für mich kleiner, als er vielleicht aussieht.
Ich denke schon, dass sich per Interaktivität bestimmte Dinge und Handlungen viel unmittelbarer abbilden lassen als in einem traditionellen Medium. Der Zwang zur Interaktion hat aber auch Tücken. Mit interaktiven Medien muss man interagieren, sie erwarten Eingaben. Das kann für eine Dramaturgie, auf der Nutzer- wie auf der Autorenseite, auch sehr störend sein.
Interaktiv heißt bei Schriftstellern, dass sie alle drei Jahre auf Lesereise gehen und sich den Fragen der Leser stellen. Wie sieht Ihr Selbstverständnis demgegenüber aus?
Für interaktive Autoren ist der Begriff schon etwas anders gefüllt: zunächst beim Schreibprozess selbst, aber natürlich auch bezüglich der „Abgeschlossenheit“ des Werks. Bestimmte erzählerische Spiele werden ja nach ihrem Erscheinen permanent weiterentwickelt, verändert, um neue Inhalte ergänzt. Gerade Online-Spiele haben oft Live-Teams, auch darunter Autoren, die sehr schnell und sehr flexibel mit den Rückmeldungen der Nutzer umgehen müssen. Auch bei Episodenspielen, deren Produktionszyklen sehr kurz sein können, ist der inhaltliche Einfluss der Spielerschaft groß. Da kann eine Figur, die sich wider Erwarten als extrem unbeliebt erweist, schon mal im Handumdrehen das Zeitliche segnen.
Im kreativen Bereichen herrschte lange Zeit eine starke Rollenteilung vor, Texter/Autor, Designer/Hersteller, Projektmanager/Lektor usw. Interactive Writing vermischt die Rollen. Wo sind die Autoren, die für solche anspruchsvollen Aufgaben gewappnet sind?
Es ist durchaus nicht so, dass es die Rollenteilung in der Spieleindustrie nicht gäbe. Im Gegenteil, wir beobachten gerade in den letzten Jahren in den größeren Studios eine zunehmende Differenzierung und Spezialisierung der Tätigkeitsfelder. Der Beruf des „Game Writers“ oder „Interactive Writers“ ist dadurch erst möglich geworden. Wahr ist allerdings, dass ein Grundverständnis für das Funktionieren von interaktiven Erzählungen in Games – also ein Wissen um die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen interaktiven Erzählens – für Autoren in diesem Feld unverzichtbar ist. Das fundamentale Verständnis für die technische und inhaltliche Umsetzbarkeit muss ein Autor mitbringen; sonst schreibt er höchstwahrscheinlich am Spieler, am Team und letztlich am Medium vorbei. Ich glaube aber, dass wir gerade eine ganze Generation sehen, die mit interaktiven Medien groß geworden ist und den Umgang gewissermaßen im Blut hat. Aus dieser Generation werden viele neue Autoren kommen.
„Ich betrachte Spiele als multimediale Kulturäußerungen – und selbstverständlich als Kulturbeiträge – im Sinne von Werken, die Bezüge zur Kultur- und Erzähltradition, zum Zeitgeschehen“, haben Sie einmal gesagt. Erfahren Spiele genügend Anerkennung im Kulturbetrieb?
Sagen wir so: Es ist viel besser geworden. Bis vor einigen Jahren hielten Feuilletonredakteure das Thema kaum für wert, sich damit zu befassen. Viele spielten wohl auch gar nicht, vielleicht sogar prinzipiell nicht. Die spezialisierte Games-Presse andererseits befasste sich fast ausschließlich aus einer technischen Perspektive mit den Spielen, wollte und konnte inhaltliche Bewertungen kaum leisten. Ich meine keineswegs, dass alle – oder auch nur viele – Spiele feuilletonwürdig wären. Aber wenn denn welche erscheinen, die es sind – und das erleben wir immer häufiger –, dann sollte es auch jemand merken. Inzwischen rücken Redakteure in die Feuilletons auf, die selbst mit Spielen aufgewachsen sind. Zugleich erleben wir eine sehr interessante und überfällige Debatte zum Selbstverständnis der Games-Presse. Auch die Spiele verändern sich, und das müssen sie. Was die kulturelle Wahrnehmung von Games angeht, gibt die Lage deshalb im Moment viel Anlass zu Optimismus. Viele Dinge bewegen sich da aufeinander zu.
Buch und Games und Online-Communities verschwimmen, wie „Pottermore“ zeigt. Ist das ein Weg für die Zukunft?
Das wird sich zeigen müssen. Nicht alle Inhalte sind gleich gut geeignet, in interaktive Anwendungen, Spin-Offs oder Online-Universen adaptiert zu werden. Das ist kein Makel, sondern schlicht eine Frage der Beschaffenheit des literarischen Stoffes. Harry Potter bietet zahllose Möglichkeiten für interaktive Weiter- oder Wiederentwicklung. Aber man muss auch sehen, dass es sich bei Potter um ein Roman-Universum handelt, wie es wahrscheinlich nur alle paar Jahrzehnte einmal vorkommt.
Was Games- und Buchbranche gleichermaßen tangiert, ist die Tatsache, dass die großen Portale wie der App Store von Apple oder das Kindle-Programm von Amazon den Kreativen ermöglichen, den direkten Weg zum Kunden zu gehen. Welche Rolle haben Verlage/Gamespublisher dann noch?
Mit der digitalen Distribution sind die Kräfteverhältnisse sicher in Bewegung gekommen. Für das Geschäftsmodell der Entwickler in der Gamesbranche ist das eine gute Sache, denn bis kürzlich gab es durch das traditionelle Publishingmodell nur wenige Studios, die überhaupt je die Chance hatten, Eigenkapital zu bilden. Auch und gerade für die kreative Indie-Szene, die sozusagen mit „Muskelhypothek“ Projekte stemmt, ist der direkte geschäftliche Draht zu den Spielern ein Segen. Man darf dennoch nicht übersehen, dass große Produktionen nach wie vor von erheblichen Vorfinanzierungen und entsprechendem Marketing-Aufwand abhängen. In gewissem Umfang gilt das sicher auch für die Buchverlage. Und den paar Handvoll wunderbaren Erfolgsstorys von Auf-eigene-Faust-Autoren und Indie-Games-Lieblingen steht eben auch eine Riesenzahl von Fällen gegenüber, in denen einfach gar nichts passiert – obwohl das Produkt ganz gut ist.
„Geschäftsmodellwandel (Free-to-Play) sowie Plattformveränderungen (Mobile Gaming mit Touch- Geräten jeder Art, starke Onlineorientierung) fordern von den kreativen Produzenten neue und bessere Angebote um sich gegen die Mitbewerber abzugrenzen“, erklärte Prof. Lietzkow im Interview mit buchreport.de. Wie stellen Sie sich auf diesen Wandel ein?
Ich versuche, neugierig, adaptiv, flexibel zu bleiben – und über den Hype der Woche hinaus gewisse Grundsätze zu bewahren. Stories sind ein äußerst robuster und erprobter Teil der menschlichen Kultur. Ihre wichtigste Plattform ist das Gehirn. Dort müssen die Sachen letztlich laufen. Wer das nicht vergisst, muss meines Erachtens neue Gadgets und Geschäftsmodelle nicht fürchten.
Die Fragen stellte Daniel Lenz
Zur Person
Martin Ganteföhr, Jahrgang 1969, studierte Sprach- und Literaturwissenschaften in Bremen und Osnabrück. 1998 gründete er das Entwicklungsstudio House of Tales Entertainment, dessen Creative Director er bis 2010 war. Sein Werk umfasst bisher 23 veröffentlichte Software-,Edutainment- und Entertainmenttitel – unter ihnen namhafte Erzählarbeiten wie „The Moment of Silence“ und „Overclocked“, aber auch Lizenztitel wie „X-Files“ und „Verliebt in Berlin“. Seit 2010 arbeitet Ganteföhr als freier Game Designer; daneben ist er als Dozent am Cologne Game Lab und freier Autor bei ZEIT Online tätig.


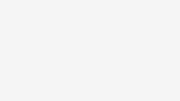



Kommentar hinterlassen zu "Wenn der Nutzer die Geschichte bestimmt"