Es ist nicht leicht, einen Beitrag zum Thema Self Publishing zu schreiben. Nicht, weil ich nichts zu sagen hätte. Ganz im Gegenteil. Vielmehr deshalb, weil ich als Eigenverleger immer in den Verdacht gerate, mich und meine Bücher in den Vordergrund zu stellen. Es bleibt somit dem Leser an dieser Stelle überlassen, ob er den Beitrag als “Eigenwerbung” abtut oder als Möglichkeit wahrnimmt, sich über die Gegebenheiten des Verlagswesens zu informieren. Freilich, ich bin kein Insider, eher ein Zaungast oder – wie man dem Eigenverleger gerne unterstellt – der Nichteingeladene einer fetzigen Party. Kommen wir gleich mal zu meinen Überlegungen. Sie sind freilich nicht vollständig, sollten aber als Diskussionsgrundlage dienlich sein.
*
Ein self publisher wird vor allem dann wahrgenommen,
wenn er den Zahlen- und Geldfetisch der Gesellschaft befriedigt,
wenn er es schafft, von den Mainstream-Medien akzeptiert zu werden,
wenn er bereits eine renommierte Marke ist (Celebrity-Cult),
wenn er bereit ist, viel Geld für Werbung und Marketing in die Hand zu nehmen,
wenn er Teil einer verschworenen Community ist,
wenn er den Schein aufrechterhält, mit seinen Büchern erfolgreich zu sein,
wenn er zum “Geheimtipp” avanciert und es hip ist, “Außenseiterliteratur” zu lesen.
.
Ein self publisher wird vor allem dann kommerziell erfolgreich sein können,
wenn er sich der Ratgeberliteratur zuwendet,
wenn er sich der Feel-good-Literatur zuwendet,
wenn er sich dem Sachbuchbereich zuwendet,
wenn er ein “herzeigbarer Selfmademan” ist,
wenn er ein großes persönlich-familiäres Netzwerk um sich hat,
wenn er eine gesellschaftliche Nische bedient,
wenn er eine noch nicht ausgereizte Subkultur bedient,
wenn er den Schein aufrechterhält, in einem Bereich ein Experte/Meister zu sein,
wenn er bereit ist, den Wert eines Kleinwagens in sein Projekt zu investieren,
wenn er zumindest seinen Text einem Korrektorat angedeihen lässt,
wenn er den Umschlag nach professionellen Gesichtspunkten herstellt.
.
Ein self publisher wird kommerziell erfolglos sein,
wenn er sein Augenmerk nur auf den belletristischen Bereich legt,
wenn er den Fokus auf Qualität legt, die der gewöhnliche Leser nicht bemerken kann,
wenn er mit den Produkten von Verlagshäusern in Konkurrenz steht,
wenn er intensivst die Social Media Kanäle bespielt und dabei unpersönlich wird,
wenn er nicht den Schein aufrechterhalten kann, mit seinen Büchern erfolgreich zu sein,
wenn er stupide dem traditionellen Verlagswesen hinterherhechelt,
wenn er mit dem traditionellen Verlagswesen aneckt.
.
Ein self publisher wird innerlich erfolgreich sein,
wenn er einer “inneren Stimme” folgt bzw. einen Musenkuss hatte,
wenn er das Maximum aus den Gegebenheiten herausholte,
wenn er neue Wege ausprobiert,
wenn er sich von äußeren Umwelteinflüssen nicht kleinkriegen lässt,
wenn er stetig dazulernt,
wenn er nicht aufgibt,
wenn er sein schlimmster Kritiker bleibt,
wenn er zumindest einen Leser gewinnen konnte,
wenn er sich nicht dem Geld- und Zahlenfetisch ausliefert.
*
Das traditionelle Verlagswesen, so lesen wir, kämpft ums Überleben und um Marktanteile. So mag es nicht verwundern, wenn die größten Verlags- und Medienhäuser fusionieren. In der zweiten Hälfte des Jahres 2013 soll Random House mit Penguin Books verschmelzen. Wenn man sich ansieht, welch internationales Medienkonglomerat die Muttergesellschaft von Random House ist, kann einem schon recht schwindlig werden, ob der Zahlen und Ziffern. Fakt ist aber, dass Self Publishing einer der am schnellsten wachsenden Sektoren im Verlagswesen ist. In den USA wurden 2010 etwa 133.000 Titel im Eigenverlag publiziert. Ein Jahr später waren es bereits 211.000 Titel. Es ist somit nur folgerichtig, dass die großen Verlagshäuser auf diesen Zug aufspringen und Self-Publishing-Portale übernehmen. Ob das am Ende gut oder schlecht für den Self Publishing Bereich ausgeht, ist nicht vorherzusehen. Die Geschichte lehrt uns, dass Konzerne eine Konkurrenz, die im Wachsen ist, übernehmen, um sie dann in ihrem Sinne zu formen. Beispielhaft sei hier die “General Motors streetcar conspiracy” erwähnt.
Ein Bestseller wird gemacht und kostet einen Verlag viel Geld. Das wusste schon Italo Calvino, als er in den 1960ern Jahren nach New York eingeladen wurde und dort bemerkte, dass der amerikanische Verlag für sein neues Buch einen Werbeetat von gerade einmal 4.000 Dollar (nach heutigem Geldwert) veranschlagte. Calvino war entsetzt und meinte, dass man mindesten 4 Millionen Dollar locker machen müsste, um auf dem Markt etwas bewegen zu können. Deprimiert stellte er fest, dass sich die großen Verlage in den USA vorrangig um ihre Bestseller kümmern und ihnen gar nichts daran läge, ein Buch auf dem Markt “durchzusetzen”. [Quelle: Italo Calvino, Eremit in Paris, Autobiographische Blätter, München 2000, S. 34]
Wir sehen, ohne dass ich es wollte, bin ich bereits beim lieben Geld angelangt. Am Ende, das mag jetzt keine große Neuigkeit sein, dreht sich alles ums Geld. Auch wenn das Verlagswesen so tut, als würde es um die schöne Literatur gehen, Fakt bleibt, dass jedes Unternehmen gezwungen ist, profitabel zu sein – ansonsten würde es vom Markt verschwinden. Das Buch wird zum “Non-Food”-Produkt. Gewiss, manch kleine und mittlere Verlagshäuser sehen im Buch noch immer ein kulturelles Erbe, das erhalten werden soll. Es ist interessant zu beobachten, wie sich diese Verlage gegen Self Publisher abgrenzen und zur Wehr setzen, während sie von den Verlagskonzernen und dem Handel an die Wand gefahren werden. Die Frage, die ich mir hin und wieder stelle, scheint mir berechtigt: Worin liegt der Unterschied zwischen einem engagierten Kleinverlag, der eine Hand voll Mitarbeiter beschäftigt und einem Eigenverleger? Beiden ist gemein, dass sie dem “Produkt” Buch eine sehr persönliche Note geben und voller Hingabe und Leidenschaft zu Werke gehen. Dass diese persönliche Note, diese Leidenschaft, im grauen Alltag des Wirtschaftslebens untergeht, wo am Ende des Tages die Kassa stimmen muss, dürfte hinlänglich bekannt sein.
Es ist weder der literarische Wert noch die Qualität des Produktes, die im Verlagswesen zählen, sondern die Quantität. Jetzt wird es persönlich. Wie oft werde ich gefragt, ob ich von meinen selbst verlegten Büchern leben könne. Wie oft werde ich gefragt, wie viele Bücher ich denn so in der Woche/im Monat/im Jahr/insgesamt verkaufe bzw. verkauft habe. Immer geht es zu aller erst um Zahlen. Meine Antworten bleiben vage und unbestimmt. Das hat den Grund, weil ich weiß, dass meine “Verkaufszahlen” in den Ohren des Fragestellers immer zu gering sind. Ich weiß auch, dass ich dadurch im “Geschäftswert” sinke. Würde ich also täglich tausende Stück meiner Bücher verkaufen, es würden sich eine Vielzahl an Medien- und Geschäftsleuten und Bewunderern einstellen. Ich glaube, dass dieser Zahlen- und Geldfetisch mit der Amerikanisierung des europäischen Kontinents zu tun hat. Es war ein Wiener Dichter, der in den 1830ern in die USA auswanderte, aber es keine zwei Jahre dort aushielt. Er stellte mit Abscheu fest, dass es dem geschäftigen Amerikaner nur um “Dollars ginge”. [Lenau’s Leben, Großentheils aus des Dichters eigenen Briefen von seinem Schwestermanne Anton X. Schurz. Erster Band. J. G. Cotta’scher Verlag, Stuttgart/Augsburg 1855, S. 196ff]
Aber was immer der Grund für diesen Zahlen- und Geldfetisch auch sein mag, er hat Besitz vom Menschen genommen. Das Verlagswesen und ihre “Produkte” sind nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Frei nach dem Motto: Die Gesellschaft bekommt jene Bücher, die sie verdient.
Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass ein freiwilliges Zusammenspiel zwischen self-publishing-Autoren auf der einen Seite und “privaten Buchherstellern” auf der anderen Seite entsteht. Mit anderen Worten, es würden sich Lektoren, Grafiker, Testleser, Marketing- und Medienleute finden, die in ihrer Freizeit gemeinsam Bücher herstellen und dabei dem kommerziellen Aspekt nur eine geringe Bedeutung beimessen. Es wäre demnach die Demokratisierung des Verlagswesens. Die Möglichkeiten dazu sind heutzutage längst gegeben, es braucht nur noch die Bereitschaft jedes Einzelnen, seinen Teil zu diesem Projekt beizutragen. Ich sage es deshalb, weil ich in den letzten Jahren bemerkt habe, wie einseitig und unausgewogen der Mainstream-Medien-Apparat und die großen Verlagshäuser die Welt “befruchten”. Von diesen dürfen sich die Bürger keine “zweite Aufklärung” erhoffen. Deshalb schließe ich mit einem Zitat von Pulitzer-Preisträger und ehemaligen New York Times Korrespondenten Chris Hedges:
“Der Sinn von ‘Brot und Spiele’ ist jener, wie Neil Postman in seinem Buch Amusing Ourselves to Death sagt, abzulenken, emotionale Energie auf das Absurde und Triviale und Spektakuläre zu lenken, während man rücksichtslos seiner Rechte beraubt wird. Ich habe mich gefragt: Hat Huxley recht oder hat Orwell recht? Es stellt sich heraus, dass sie beide recht haben.” (“The purpose of bread and circuses is, as Neil Postman said in his book Amusing Ourselves to Death, to distract, to divert emotional energy towards the absurd and the trivial and the spectacle while you are ruthlessly stripped of power. I used to wonder: Is Huxley right or is Orwell right? It turns out they’re both right”, übersetzt nach: David Barsamian, Interview with Chris Hedges, in: The Progressive Ausgabe August 2011, online abrufbar.”)
___
Richard K. Breuer lebt und arbeitet in Wien. Wirtschaftlich geprägte Schulausbildung. Verschiedene Jobs im Banken- und Softwarebereich. Seit 2003 freiberuflicher Schriftsteller, Dramatiker, Drehbuchautor, Designer, Blogger und Verschwörungstheoretiker. Absolvent des zweisemestrigen Verleger-Seminars in Kooperation mit der Universität Wien bei Prof. Mazakarini. Verleger seit 2008.
Veröffentlichungen: Die Liebesnacht des Dichters Tiret (2008), Rotkäppchen 2069 (2008), Schwarzkopf (2009), Brouillé (2010), Madeleine (2012). Autor der Woche (ORF Radio NÖ). Die Krimikomödie Schwarzkopf wurde in der Leipziger Volkszeitung und Falter Buchbeilage besprochen. Das Magazin hörBücher vergab in der Ausgabe 4/11 für Schwarzkopf die höchste Benotung (“grandios”).
Der Beitrag wurde zuerst auf SteglitzMind veröffentlicht, vielen Dank für die Genehmigung der Zweitveröffentlichung.











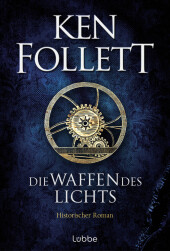
Schön, dass dieses lesenswerte Essay auch hier veröffentlicht worden ist.
Schade nur, dass das vorangestellte Zitat von Neil Postman (aus dessen Eröffnungsrede zur Frankfurter Buchmesse 1984) nicht übernommen worden ist. Auf dieses Zitat am Anfang bezieht sich nämlich das Zitat am Ende des Essays, das sonst leider ein wenig „in der Luft hängt“.
“Was Orwell fürchtete, war der Moment, wo Bücher verboten werden würden. Was Huxley fürchtete, war der Moment, wo es keinen Grund mehr geben würde, überhaupt Bücher zu verbieten, weil es niemanden mehr gäbe, der sie lesen hätte wollen.” (“What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one.”)
Wie Recht doch der Mann hat!