Das Thema „Open Access“ in der Wissenschaft, bei dem der Autor, seine Institution oder Forschungsförderer für die Veröffentlichung zahlen, um die kostenlose Nutzung in der Wissenschaftscommunity zu gewährleisten, wird aktuell wieder intensiv diskutiert. „Open Access“ war ein zentrales Thema auf der Tagung Academic Publishing in Europe (APE, 11./12.1) in Berlin. Kurz darauf hat die „Financial Times Deutschland“ (FTD, 14.1) einen großen Beitrag zum Thema veröffentlicht. Die Breite der Diskussion der APE hat der Autor offenbar nicht reflektiert.
Die wichtigsten Thesen des FTD-Beitrags „World Wide Wissenschaft“ (S. 15) von Frank Bebber:
- Bevor es das Internet gab, veröffentlichten Forscher ihre Entdeckungen in Fachblättern. Die Thesen wurden von Kollegen geprüft und bei ausreichender Qualität frei gegeben.
- Durch dieses System hätten die Fachblätter Abogebühren diktieren können. „Jahrelang haben die Fachverlage die Preise hochgeschraubt, doch vor einigen Jahren haben sie den Bogen überspannt und die Universitätsbibliotheken bestellten reihenweise Fachzeitschriften ab“, bewertet Bebber die Lage.
- In Deutschland hätten die Hochschulen im Jahre 2009 über 100 Mio. Euro für gedruckte und digitale Fachmagazine ausgegeben. Um die immensen Kosten zu sparen, hätten sie Forscher dabei unterstützt, ihre Arbeiten für jeden frei zugänglich ins Netz zu stellen.
- Für die wissenschaftlichen Autoren sei die Lage zwiespältig: Sie beklagten die hohen Preise, die dazu führten, dass sie weniger gelesen würden. Andererseits profitierten sie vom Renommee der Zeitschriften.
- Dank des Internets und des Engagements der Bibliotheken sei die Entwicklung zu Open Access inzwischen unaufhaltsam, immer mehr Artikel würden online publiziert. Die Ergebnisse öffentlich finanzierter Forschung müssten nicht länger nicht mit öffentlichen Geldern zurückgekauft werden.
- Die Verlage seien in die Enge getrieben worden und hätten ihr Geschäftsmodell angepasst: Autoren erhielten nun freien Zugang zu Verlags-Fachportalen, die Qualität der Artikel werde weiterhin durch Begutachtung sichergestellt. Diese Dienstleistung würde von den Autoren, nicht mehr vom Leser bezahlt. Diese Gebühren seien mittlerweile in vielen Forschungsetats eingespeist.
Es klingt, als hätten die „geldgierigen“ Verlage aufgegeben (auch wenn der Begriff nicht wörtlich fällt) und alle Beteiligten eine angemessene Lösung gefunden.
Eine Ansicht, die Verlagsberater Ehrhardt F. Heinold nach der Diskussion auf der APE nicht teilen kann. „Der Artikel ist eine saubere Darstellung dessen, was viele Wissenschaftler denken“, erklärt er gegenüber buchreport.de. So hatte auch Jos Engelen, Präsident der niederländischen Regierungsorganisation für Forschung zum Thema Open Access Publishing (OA) auf der APE dafür plädiert, Institutionen oder Forschungsförderer für Publikation zahlen zu lassen und das Gebührenmodell umzudrehen. Doch bei genauerer Betrachtung der Problematik werde klar, so Heinold, dass die im Artikel dargestellte Situation der Stand der Dinge von 2003 sei.
Viele Verlage und Wissenschaftler seien sich inzwischen einig, dass sich durch Open Access kein Geld sparen lasse. Die im Artikel genannten 800 bis 1250 Euro seien laut Gesprächen mit Verlegern eher die untere Grenze der Beiträge. Nur ein geringer Bruchteil der Artikel werde ausschließlich über Open Access veröffentlicht. Schließlich sind die Wissenschaftler auf das Renommee der Zeitschriften angewiesen, oft veröffentlichen sie ihre Artikel parallel auf Open-Access-Plattformen und in Zeitschriften.
Die Verlage positionieren sich aus folgenden Gründen immer als der beste Partner für Publikationen:
- Marken: Viele Zeitschriften aus Verlagen sind führend in ihrem Fachgebiet und bieten die besten Marken, in denen jeder Wissenschaftler publizieren möchte.
- verlässliche Qualitätssicherung
- professioneller Publikationsprozess bis hin zu Marketing und Distribution
- Sicherstellung einer Langzeitarchivierung
- Sicherung von Zugänglichkeit und Auffindbarkeit der Publikationen
- autorenfinanziertes Publizieren kostet Geld, das Autoren bzw. deren Forschungseinrichtungen oft nicht haben
Im Großen und Ganzen macht Open Access bisher nur einen Bruchteil aller Publikationen aus, kann aber in einigen Nischenbereichen durchaus Erfolge aufweisen. Das traditionelle Geschäftsmodell der Verlage bzw. – im Falle der forschungsfinanzierten Publikationen ihre Funktion – bleibt erhalten, auch wenn es inzwischen offen zugängliche Plattformen gibt, die sich erfolgreich positionieren konnten und deren Einfluss sicher noch wachsen wird.
Mittlerweile sehen die Verlage das Thema sehr gelassen: Sie bieten längst jedem Wissenschaftler Open Access-Publikationsmöglichkeiten an – doch diese werden aus den genannten Gründen kaum genutzt.










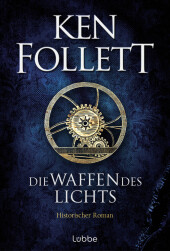
Kommentar hinterlassen zu "Wissenschaft braucht Fachverlage"