 Beruflich pendelt er zwischen Schreibtisch und Podien: Hinrich Schmidt-Henkel zählt zu den bekanntesten Übersetzern. Der Spagat zwischen Geist und Geld erfordert große Disziplin. Ein Porträt.
Beruflich pendelt er zwischen Schreibtisch und Podien: Hinrich Schmidt-Henkel zählt zu den bekanntesten Übersetzern. Der Spagat zwischen Geist und Geld erfordert große Disziplin. Ein Porträt.
Um kurz vor 19 Uhr muss Hinrich Schmidt-Henkel umdisponieren. Schon vor einer halben Stunde eilte die Rezeptionistin zu seinem Tisch, um dem Berliner mitzuteilen, er möge möglichst schnell im Bochumer Schauspielhaus anrufen. Da ahnt Schmidt-Henkel bereits, was er erst später am Telefon erfährt: Jon Fosse hat den Flieger verpasst. Unmöglich, dass der norwegische Romancier und Theaterautor rechtzeitig zur geplanten Lesung um 20.30 Uhr im Theater eintrifft. Vor 22 Uhr keine Chance. Anders als die Bochumer Organisatoren bleibt Fosses deutscher Übersetzer gelassen. Plan B steht nach wenigen Minuten. Nach eigener Lesung aus Texten des Norwegers, dessen „Todesvariationen“ in Bochum als deutschsprachige Erstaufführung gezeigt werden, will Schmidt-Henkel in einem Gespräch mit dem Dramaturgen Thomas Oberender dem Publikum das Fosse-Faszinosum vermitteln. Der Plan geht auf. Über 100 Zuschauer sitzen noch im Saal, als Jon Fosse mit zweistündiger Verspätung endlich aufs Podium tritt, um aus seinem Werk zu lesen. Zu diesem Zeitpunkt haben viele längst vergessen, dass der Abend zunächst anders geplant war.
Es ist kein Zufall, dass der Mann, der Autoren wie Louis-Ferdinand Céline, Jean Echenoz, Erik Fosnes Hansen oder Henrik Ibsen eine deutsche Stimme verleiht, in seiner Dankesrede zur Verleihung des vom Deutschen Literaturfonds vergebenen Celan-Preises seine Rolle als Übersetzer mit der eines Schauspieler verglich. Um den Ton des Autors zu treffen, sei Anverwandlung unumgänglich, eine Mischung von rückhaltloser Empathie und professioneller Distanz zur Gedankenwelt des Autors, deren Balance besonders bei der Neuübersetzung von Célines „Reise ans Ende der Nacht“ schwierig gewesen sei.
Ebenso wie Schauspieler liebt Schmidt-Henkel den öffentlichen Auftritt. Er will spüren, wie sich Literatur beim Zuhörer unmittelbar auswirkt. Zwar arbeitet er seit 1988 hauptberuflich als Übersetzer, nebenher hat der Berliner jedoch viel Erfahrungen auf Bühnen und Podien gesammelt: So u.a. als persönlicher Referent und Pressesprecher der damaligen Hamburger Kultursenatorin Christina Weiss oder als Leiter von Übersetzerseminaren. Das In-Sich-Versinken des Sprachjongleurs am Schreibtisch und das Extrovertierte sind für den 45-Jährigen verschiedene Daseinsformen einer einzigen Person und ihres Interesses für Literatur.
Ursprünglich wollte er Lehrer werden. Doch noch während des Referendariats im Saarland sattelte Schmidt-Henkel um. Ermutigt und mit ersten Aufträgen versorgt von Eugen Hemlé, dem bedeutenden Übersetzer aus dem Französischen, schied Schmidt-Henkel aus dem sicheren Beamtenleben aus, um als Übersetzer zu arbeiten, zunächst für Kinder- und Jugendliteratur, später für Belletristik und Theatertexte – ein mühsamer Weg als Klinkenputzen bei Verlagen, ein anstrengendes Schaulaufen auf der Buchmesse.
Erst neun Jahre später brauchte Schmidt-Henkel keine Aufträge mehr zu akquirieren. Heute kann er seinen hehren Anspruch verfolgen, keine Bücher, sondern Autoren zu übersetzen, darf Aufträge ablehnen, ohne fürchten zu müssen, beim nächsten Mal vom Verlag übergangen zu werden. Er hat die Gewissheit, dass Lektoren ihn als Übersetzer engagieren – ähnlich wie Regisseure ihre Rollen nach den Stärken der Schauspieler vergeben. Nach mehreren Preisen (z.B. Jane-Scatcherd-Preis der Heinrich-Maria-Ledig-Rowohlt-Stiftung 2000), vom Feuilleton gelobten Übersetzungen und dank zahlreicher Aktivitäten abseits des Schreibtisches hat sich der Berliner im Literaturbetrieb etabliert.
Doch trotz des eigenen Künstlercredos hat Schmidt-Henkel die Bodenhaftung nicht verloren. Er macht keinen Hehl daraus, dass der Beruf selbst für einen bekannten Übersetzer wie ihn kein Brotjob ist, dass er auf die Unterstützung Dritter angewiesen ist – und ohne Selbstausbeutung nicht auskommt. In den vergangenen Jahren sei es für Übersetzer immer schwieriger geworden, den eigenen Anspruch mit dem wirtschaftlich Existenziellen in Deckung zu bringen. Und die Zeitkorridore, die von Lektoraten vorgegeben werden, sind enger, der Arbeitsdruck ist größer geworden. Aus manchen Lektoraten seien inzwischen anonyme Produktionseinheiten geworden, in denen eine hohe Fluktuation herrsche. Immer weniger Titel reüssierten als Midseller und erreichten eine Auflage von über 10 000 Exemplaren – die magische Grenze für diejenigen unter den Übersetzern, deren Verträge eine Beteiligung an den Erlösen eines Titels vor-sehen.
Umso disziplinierter müssten Übersetzer arbeiten, um über die Runden zu kommen. Das heißt bei Schmidt-Henkel: Morgens folgt unmittelbar nach Gymnastik- und Yoga-Übungen die Textarbeit, nachmittags stehen Organisatorisches und Recherche auf dem Programm. Der Übersetzer legt keinen Wert auf eine penibel festgelegte Stundenzahl am Schreibtisch. Dennoch hat er kalkuliert, dass acht Seiten pro Tag das Minimum sind, um wirtschaftlich zu arbeiten – dies entspreche einem Umsatz von rund 160 Euro, von dem nach Steuern höchstens die Hälfte übrig bleibt. Übersetzer, die dieses Pensum nicht schaffen, sollten nach Methoden suchen, mit denen sie die Effizienz ihrer Arbeit steigern können, fordert Schmidt-Henkel.
Kein Vertrag ohne Beteiligung – mit dieser Grundregel hat der Übersetzer einige Male schlechte Erfahrungen gemacht. Mit Bedauern erinnert er sich an die interessanten Gespräche mit Joachim Unseld von der Frankfurter Verlagsanstalt, die dann an jenem Passus gescheitert sind. Hart geht Schmidt-Henkel mit Hardlinern im Gewand von Alt-68ern ins Gericht. Dennoch gehört er nicht zu denjenigen Mitgliedern des Übersetzerverbands, die per se eine Verdreifachung ihrer Honorare verlangen. Beide Seiten, Übersetzer und Verlage, müssten aufeinander zugehen. Nur dann könne aus dem Zuschussgeschäft ein Brotjob werden.
Daniel Lenz
Zur Person: Hinrich Schmidt-Henkel
Geboren 1959 und wohnhaft in Berlin. Nach dem Studium der Germanistik und Romanistik an der Universität des Saarlandes seit 1988 als hauptberuf-licher Übersetzer für norwegische, französische und italienische Literatur tätig. Von 1991 bis 1993 persönlicher Referent, dann Pressesprecher der Hamburger Kultursenatorin Christina Weiss. Nebenberuflich Konzeption, Moderation und/oder Übersetzung von literarischen Veranstaltungen; Lesereisen mit Autoren und eigene Lesungen; 2000/01 Konzeption des deutschen Auftritts beim Salon du Livre 2001; Leitung von Übersetzerseminaren, 2004 Leitung der Autorenwerkstatt Theater am Literarischen Colloquium Berlin. Autor für das Arte-Kulturmagazin „Karambolage“.
Auszeichnungen: 2000 Jane-Scatcherd-Preis der Heinrich-Maria-Ledig-Rowohlt-Stiftung; 2004 Celan-Preis des Deutschen Literaturfonds.







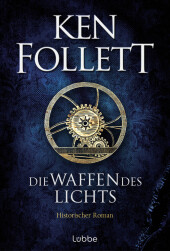
Kommentar hinterlassen zu "Célines deutsche Zunge"