
Kaum eine Firma polarisiert so stark wie diejenige, die einst mit dem Credo antrat, nicht „evil“ sein zu wollen. Jeff Jarvis (Foto), Journalismus-Professor in New York und Medienblogger (buzzmachine.com), analysiert in seinem Buch „Was würde Google tun?“ (bei Heyne erschienen) die Geschäftsprinzipien von Google und die Herausforderungen der Buchbranche. buchreport.de bringt einen Auszug, in dem Jarvis die Blockbuster-Economy der Verlage kritisiert, für Anzeigen in Büchern plädiert – und erklärt, warum Google kein Feind der Bücher sei.
Auszug: Kapitel „GoogleCollins: Das Buch vernichten, um es zu retten“
Ich gestehe, ich bin ein Hypokrit: Hätte ich meine eigenen Regeln befolgt – hätte ich mein eigenes Hundefutter gefressen –, würden Sie dieses Buch jetzt nicht lesen, jedenfalls nicht in Buchform. Sie würden es online lesen, und zwar kostenlos, nachdem Sie es über Links und Suchanfragen entdeckt hätten. Sie hätten die Möglichkeit, mich zu korrigieren, und ich könnte das Buch durch die neuesten tollen Statistiken über Google aktualisieren. Wir könnten uns über die Ideen, die hier angesprochen werden, austauschen. Das Projekt wäre noch kooperativer, als es dank der Leser meines Blogs ohnehin schon ist. Vielleicht würden wir auf Facebook eine Gruppe von Google- Denkern gründen, und sie könnten mehr Erfahrungen einbringen, mehr Ratschläge und neuere Wege, die Welt zu sehen, als ich allein es hier vermag. Der Verlag hätte mir keinen Vorschuss gezahlt, aber vielleicht würde ich mit Vorträgen und Beratungen Geld verdienen.
Doch ich erhielt einen Vorschuss vom Verlag. Deshalb lesen Sie jetzt ein Buch. Tut mir leid. Aber auch Hunde müssen von etwas leben. Ich befolge bereits fast alles, was ich beschrieben habe, nicht in Hinsicht auf dieses Buch, aber auf meinem Blog, wo es möglich ist, Ideen zu suchen, gemeinsam auszuarbeiten, zu aktualisieren und zu korrigieren – und wo Unterhaltungen, die durch dieses Buch angeregt werden, hoffentlich fortgesetzt werden. Ich glaube, die beiden Formen werden zusammenkommen – darum dreht sich ein Teil dieses Kapitels. Bis dahin werde ich mich nicht anstellen wie ein Idiot. Ich konnte doch keinen Scheck über eine hübsche Summe ausschlagen und auf zahlreiche Annehmlichkeiten verzichten, unter anderem Redaktion, Layout, Publicity, Vertrieb, Beziehungen zum Buchhandel, ein Rednerpult und Unterstützung per Internet. Ein Verlag ist immer noch ein Verlag, und das aus gutem Grund: Es lohnt sich. Wie lange wird das noch so sein? Wie lange sollte es noch so sein?
Ich habe vorgeschlagen, Zeitungen sollten ihre Druckerpressen abschalten, und für Buchverlage habe ich ebenfalls einen Vorschlag: Wir müssen Bücher vernichten, um sie zu retten. Das Problematische an Büchern ist, dass wir sie zu sehr lieben. Wir heben Bücher auf ein Podest und betrachten sie als höchste Ausprägung der Kultur: Objekte der Wertschätzung, hochheilig und unantastbar. Ein Buch ist wie ein britischer Akzent – was immer man sagt, klingt intelligenter, selbst wenn es das gar nicht ist. Denn selbstverständlich gibt es auch schlechte Bücher. Jede einzelne Folge von The Office, The Wire oder Weeds, um nur einige aktuelle Beispiele zu nennen, ist besser als zahlreiche der Bücher, die in so manchem Regal stehen. Dennoch tun wir das Fernsehen als die niedrigste unserer kulturellen Errungenschaften ab. Wir erlauben der Regierung, Sendungen zu zensieren, doch wir würden niemals zulassen, dass Bücher verboten werden. Bücher sind uns heilig. Wir müssen über Bücher hinwegkommen. Nur dann können wir sie neu erfinden. Bücher sind nicht perfekt. Sie sind Gefangene ihrer Zeit, denn es gibt keine Möglichkeit, sie zu aktualisieren oder zu korrigieren, außer über Neuauflagen. Innerhalb ihrer gedruckten Form kann man keine Suchanfrage starten. Sie schaffen eine einseitige Beziehung. Bücher klären Leser auf, das mag ja sein, aber sind sie erst einmal geschrieben, können sie den Autor schwerlich noch etwas lehren. Sie führen nicht über Links zu weiterführenden Kenntnissen, Diskussionen oder Informationsquellen wie das Internet. David Weinberger brachte mir in Everything’s Miscellaneous bei: Wenn Wissen auf einer Seite gefangen ist, bleibt es auf einem bestimmten Platz im Regal unter einer bestimmten Adresse stehen, und man kann es nur über einen einzigen Weg erreichen. Im Internet-Zeitalter, wo so viele Wege zu Wissen führen, zeigt sich ein weiterer Nachteil an Büchern. Ihre Herstellung kostet viel Geld. Sie blockieren Platz im Regal. Sie vernichten Bäume. Sie basieren auf der Blockbuster-Economy, was bedeutet, nur wenige sind Gewinner, die meisten sind Verlierer. Sie sind dem Geschmack und den Launen kultureller Türsteher unterworfen.
Es werden nicht genug Bücher gelesen, da sind wir uns sicher einig. Don Poynter von BookStatistics.com förderte ernüchternde Zahlen über die Branche und Lesegewohnheiten zutage. Unter Berufung auf Book.Publishing.com meldet er, 80 Prozent der Familien in den USA kaufen oder lesen nicht einmal ein Buch pro Jahr. 70 Prozent der Erwachsenen in den USA waren seit fünf Jahren in keiner Buchhandlung mehr. 58 Prozent der Erwachsenen in den USA lesen nach Verlassen der Highschool keine Bücher mehr (das steht allerdings im Widerspruch zu einer Erhebung von National Endowment for the Arts aus dem Jahr 2004, der zufolge 56,5 Prozent der Erwachsenen in den USA sagten – also zumindest behaupteten –, sie hätten innerhalb des vergangenen Jahres ein Buch gelesen). Bücher werden rausgeworfen, wenn kein Platz mehr für sie da ist, sie enden auf dem Müll oder auf dem Wühltisch des Antiquariats. 40 Prozent der Bücher, die gedruckt werden, werden nie verkauft. Bücher sind der Ort, in den man Worte steckt, um zu sterben.
Digitale Bücher haben eine Menge Vorteile. Bücher können multimedial und interaktiv werden, wie etwa die Harry-Potter- Zeitungen. Man kann sie suchen, verlinken und aktualisieren. Sie sind unsterblich und finden überall neue Leser. Man kann sich über die Ideen in Büchern unterhalten und sie neuen Lesern nahebringen. Ben Vershbow vom Institute for the Future of the Book entwickelte für das Library Journal seine Vorstellung einer digitalen Ökologie, in der »Teile von Büchern auf Teile in anderen Büchern verweisen. Bücher werden aus Elementen ferngesteuerter Datenbanken und Servern miteinander verwoben.« Kevin Kelly schrieb im New York Times Magazine: »In der neuen Bücherwelt informieren winzige Informationen sich gegenseitig; jede Seite liest alle anderen Seiten.« Wenn eine Idee verbreitet wird, kann sie wachsen und sich anpassen und eine Seite überdauern. Auf einer Tagung von Buchhändlern im Jahr 2006 bezeichnete der Autor John Updike Kellys Vision von »Beziehungen, Links, Verknüpfungen und Gemeinsamkeit « als marxistisch und als »ziemlich schreckliches Szenario«.
Es gibt allerdings ein Problem in Bezug auf all die Visionen eines digitalen Verlagsparadieses (meine eigene eingeschlossen): Geld. Wie werden die Autoren dafür bezahlt, dass sie den Aufwand auf sich nehmen, zu berichten, sich etwas auszudenken und zu schreiben, wenn so viel davon im Internet frei zugänglich ist? Das Internet ist gnadenlos. Robert Miller, ehemaliger Herausgeber von Disneys Hype rion, kam zu HarperCollins – dem Mutterkonzern meines Verlegers –, während ich dieses Buch schrieb. Seine Aufgabe bestand darin, das Unternehmen auf den neuesten Stand zu bringen, mit Blick auf das Programm, aber auch auf die wirtschaftliche Situation, die von Vorabhonoraren und Remittendenzahlen beeinflusst wurde. Schwierig ist alles, was dazwischen liegt, erklärte er mir. An der Spitze bringen Bestseller Geld, und am unteren Ende gibt es eine endlose Zahl erfolgloser Buchprojekte. (Sechs große Verlagsgruppen kontrollieren das obere Ende des Buchmarkts, Publishers Weekly meldet jedoch, insgesamt sei die Anzahl an Verlagen von 357 im Jahr 1947 auf 85 000 im Jahr 2004 gestiegen. Das sind ganz schön viele Nischen.) Die Vorauszahlungssummen an Autoren stiegen laufend und so erhöhten sich auch das Risiko und die Verluste.
Das ist ein Problem der Blockbuster-Economy: Verleger schleudern eine Menge Bücher gegen die Wand, in der Hoffnung, einige davon mögen daran haften bleiben, aber sie wissen nie, welche genau das sein werden. Obwohl es mittlerweile zahlreiche Verlagshäuser gibt, bleibt der Wettbewerb gleich. Wenn zwei Verlagsgruppen an ein und demselben Buch interessiert sind, steigt der Preis. So funktioniert das seit 1952, als der Literaturagent Scott Meredith Auktionen unter Verlegern ins Leben rief und ein Manuskript nicht mehr an nur einen Verlag geschickt wurde, wie es zwischen Gentlemen der Branche bis dahin üblich gewesen war. Heute bringen die meisten Bücher nicht einmal so viel ein, wie der Verlag dem Autor an Vorschuss gezahlt hat. Miller sagte, ein Verlagshaus laufe gut, wenn 20 Prozent der Bücher ihren Vorschuss einbringen. Stellen Sie sich einmal irgendeine andere Branche vor, wo 80 Prozent der Produkte hergestellt werden, um Geld daran zu verlieren. Das ist Irrsinn!
Millers Lösungsvorschlag: Er denkt an geringere Vorauszahlungen – höchstens etwa 100.000 Dollar –, im Gegenzug teilen sich die Autoren den Gewinn eines Buches 50 : 50 mit dem Verlag. (Zum Vergleich: Ich erhalte zehn bis 15 Prozent des Einkaufspreises an Provision für ein Hardcover und 7,5 Prozent pro Taschenbuch, die Einnahmen aus den internationalen Lizenzen werden geteilt.) Millers Ansatz läuft darauf hinaus, dass Autor und Verleger sich sowohl das Risiko als auch den Gewinn teilen.
Darüber hinaus besteht das Problem der Remittenden. Das Verlagswesen ist ein Geschäft auf Kommissionsbasis. Buchhändler können unverkaufte Exemplare an den Verlag zurückgeben – für diese Geschäftspraxis sind Simon & Schuster verantwortlich. Das heißt, Verleger tragen das alleinige Risiko, einmal ganz zu schweigen von den immensen Kosten für Druck, Versand, Lagerung und das Einstampfen unverkäuflicher Bücher. Bücher bestehen aus Atomen von vergänglichem Wert. Miller will Buchhändlern einen höheren Gewinnanteil einräumen, wenn sie das Risiko eingehen, die Bücher, die sie ordern, auch zu erwerben. Das verbleibende Risiko für Verleger und Autor bestünde dann nur noch darin, dass Buchhändler eventuell nicht genug bestellt haben, um die Nachfrage zu bedienen. Doch laut Miller sind Verlage zunehmend besser in der Lage, schnell nachzudrucken. Miller verfolgt die Absicht, das Geschäft mit Printmedien profitabler zu gestalten.
So weit, so gut. Er räumt allerdings ein, dass es noch andere Modelle gibt, die man in Erwägung ziehen könnte. Vielleicht sollte man Bücher Kapitel für Kapitel kaufen, ähnlich der Voranmeldungen auf die Bücher von Dickens: Haben Sie genug Kapitel gekauft, gehört Ihnen das Buch. (Wenn es schlecht ist, hören Sie auf, dann sparen Sie Geld. Laut BookPublishing.com werden 57 Prozent der neu erworbenen Bücher nicht vollständig gelesen). Oder man kauft die gedruckte Ausgabe eines Buchs und erhält Zugang zum Hörbuch und zu einem E-Reader, wie Amazons Kindle. Manche versprechen sich viel von Print-on-demand, was einem Händler die Möglichkeit geben würde, Ihnen schnell ein Buch zu verkaufen und Amazons Lieferzeiten zu unterbieten. Doch das ist nach wie vor teuer und es werden nur Taschenbücher herausgegeben.
Wir stellen fest, dass die Leser bereit sind, sofortigen Genuss zu honorieren. Deshalb gehen sie immer noch in Buchläden. Vielleicht könnten Verleger selbst Rabatte gewähren, wenn man in Kauf nimmt, eine Woche oder auch zwei auf ein Buch zu warten. Das würde einem Verlag die Möglichkeit geben, Aufträge zu bündeln, bis sich ein Druck lohnt. Sie könnten einen weiteren Preisnachlass einräumen, wenn der Leser bereit wäre, ein Buch im unhandlichen PDF-Format zu bestellen, denn so würden dem Verlag keine Herstellungskosten entstehen. Vielleicht könnten Leser auch Autoren oder Buchserien vorbestellen, das würde dem Verleger und dem Autor Cash-flow sichern und einen Grund geben, das nächste Buch zu publizieren. Oder Autoren könnten den Lesern mitteilen, dass sie nur dann ein Buch schreiben, wenn eine gewisse Anzahl der Leser es im Voraus bestellt.
Peter Osnos, ein weiterer Visionär des Verlagswesens, der auszog, die Branche zu retten, gründete das Caravan-Projekt. Es soll Verlegern ermöglichen, Bücher jeden Formats zu verkaufen: in herkömmlicher Form, via Print-on-demand, vollständig oder in Form einzelner Kapitel digitalisiert sowie als Hörbuch. »Wenn ein Leser nach einem Buch fragt, sollte die Antwort des Händlers grundsätzlich lauten: Wie möchten Sie es denn?‹«, schrieb er in The Century Foundation. Osnos erzählte mir, die grundlegenden Probleme des Verlagswesens bestünden in Verfügbarkeit und Bestandsmanagement. Wenn 20 Prozent der Buchverkäufe on-demand oder digital abgewickelt würden, so glaubt er, ließe sich beim Druck unverkäuflicher Exemplare genau die Summe einsparen, die man in das Marketing investieren müsse, um das Geschäftsmodell in Gang zu bringen. An dem Tag, als Google den neuen Chrome- Browser vorstellte, hatte Osnos einen Auszug aus der New York Times gelesen, in dem es hieß, Google müsse das eigene Schicksal in die Hand nehmen. In diesem Sinne sollten auch Verleger tun, was Google tut, erklärte er: Ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen.
Rick Smolan – allseits bekannt, nachdem er in Zusammenarbeit mit tausend Top-Fotoreportern America 24/7 herausgab, die Chronik einer Woche im Leben der Vereinigten Staaten – fand einen weiteren Weg, seine aufwendigen und teuren Fotobände zu finanzieren: Sponsoring. »Warum?«, fragte Smolan und erklärte: »Weil kein Verlag unser erstes Buch, A Day in the Life of Australia, herausbringen wollte, wandten wir uns an Vertreter der australischen Wirtschaft und brachten das Buch selbst heraus. Es wurde zur Nummer eins in Australien und verkaufte sich 200 000 Mal (auf einem Markt, wo 10 000 Exem plare schon einen Bestseller ausmachen).« Vor kurzem veröffentlichte er America at Home und ein Pendant für Großbritannien, jeweils mit Unterstützung des bekannten Sponsors IKEA, der nur einen geringen Teil der Lorbeeren beanspruchte. (Smolan hatte eine weitere innovative Idee: Gegen Bezahlung Korsollten die Leser jedes der Bücher mit ihrem eigenen Foto auf dem Cover erhalten.)
Warum sollten Bücher sich nicht über Anzeigen finan zieren, wie das Fernsehen, Zeitschriften, der Rundfunk und Websites es längst praktizieren? Anzeigen in Büchern wären weniger störend als Werbeunterbrechungen während Fernsehsendungen oder Werbebanner, die uns auf einer Website anblinken. Wären Werbeanzeigen in diesem Buch verwerflicher als in einer Story, die ich für BusinessWeek geschrieben habe? Das müssten Sie mir erklären. Wenn ich einen Sponsor oder auch zwei für dieses Buch gewonnen hätte, was würden Sie dann von meiner Arbeit halten? Wenn Dell eine Anzeige geschaltet hätte – weil ich nur noch Gutes über sie verbreite –, würden Sie sich fragen, ob ich mich an das Unternehmen verkauft habe? Ich fürchte, genau das würden Sie denken. Was wäre mit einer Anzeige von Google? Das ginge bestimmt nicht. Yahoo? Ha! Wer wollte sich mit jemandem auseinandersetzen und sich mit den Denkansätzen dieses Buches identifizieren, wenn er gleichzeitig dazu beitragen würde, es zu verbreiten? Hätte es Einfluss auf Ihre Einschätzung, wenn Sponsoring den Preis des Buches senken würde? Aus Sicht des Verlegers könnte man so das Risiko minimieren und den Gewinn steigern. Aus meiner Perspektive könnte es bedeuten, das Buch kostet weniger, also verkauft es sich besser, und die ausgeführten Ideen finden weitläufiger Verbreitung. (Besuchen Sie meinen Blog und lassen Sie uns über Anzeigen in der Taschenbuchausgabe diskutieren. Vielleicht bringen wir über eBay ein paar Seiten an den Mann.)
All diese Ansätze vernachlässigen nach wie vor die größte Herausforderung, die das Internet darstellt: gratis. Das Gratismodell wird das Verlagswesen genauso vernichten, wie es die Musikbranche zerstört hat, oder? Vielleicht auch nicht. Vielleicht kann ein Gratismodell die Verlagsbranche retten.
Der googeligste Autor, den ich kenne, und außerdem einer der bei weitem erfolgreichsten lebenden Autoren, Paulo Coelho, hat nichts dagegen, Bücher zu verkaufen. Er hat beeindruckende 100 Millionen Exemplare seiner Romane verkauft. Er schätzt, dass weitere 20 Millionen nicht autorisierter Exemplare gedruckt wurden, in Ländern, die das Copyright missachten. Dennoch ist Coelho dafür, seine Bücher gratis ins Internet zu stellen.
Coelho lernte das kostenlose Modell in Russland schätzen, wo eine nicht autorisierte Übersetzung eines seiner Bücher im Internet veröffentlicht wurde. In weniger als drei Jahren stiegen die Verkaufszahlen seines Buches von 3000 auf 100 000 und dann auf eine Million Exemplare. »Ich dachte mir also, das liegt wahrscheinlich an der Raubedition«, erzählte er mir bei einem Gespräch in seiner Pariser Wohnung. »Das Gleiche geschah auf Englisch, Norwegisch, Japanisch und Serbisch. Wenn jetzt ein Buch als Hardcover herausgegeben wird, sind die Verkaufszahlen umwerfend. Das ist die Bestätigung dafür, dass ich recht hatte.« Er glaubt, diese Piraterie habe dazu beigetragen, ihn zum meist übersetzten lebenden Autor zu machen.
Die Raubdrucke waren derart hilfreich, dass Coelho auf seiner eigenen Homepage Links dazu einrichtete. Nachdem er auf der Burda-DLD-Konferenz 2008 in München – wo ich ihn kennengelernt habe – seine Offenheit überall herumposaunt hatte, bekam er einen Anruf von Jane Friedman, damals Chefin seines Verlags HarperCollins (Mutterkonzern meines Verlags). »Ich hatte eine Höllenangst davor, mit ihr zu sprechen, denn ich wusste, was kam: ein Donnerwetter. Sie sagte: Ich habe ein Problem mit dir.‹« Friedman hatte ihn bei Selbst- Piraterie erwischt, denn sie hatte entdeckt, dass einige der angeblich nicht autorisierten Editionen, zu denen Coelho Links eingerichtet hatte, noch seine eigenen Randnotizen und Korrekturen beinhalteten. »Sie sagte: Mensch, Paulo, bescheiß mich nicht.‹« Verlegen gab er zu, sich selbst »beraubt« zu haben. Aber er sagte auch, keiner von ihnen könne es sich leisten, das Gesicht zu verlieren, indem man die Raubeditionen zurückziehen würde. Sie bekamen schon Publicity. Also einigten die beiden sich auf einen Kompromiss: Jeden Monat sollte eins seiner Bücher kostenlos zu lesen sein, in voller Länge, und zwar als spezieller Online-Reader, der es den Usern unmöglich machte, den Text zu kopieren (oder einen entsprechenden Link ausfindig zu machen). Das war immerhin ein Anfang.
Wenn dieses Buch in Druck geht, haben HarperCollins und ich schon über zahlreiche digitale Alternativen gesprochen, unter anderem darüber, das Buch auf Grundlage dieses Readers in voller Länge einige Wochen vor seiner Veröffentlichung ins Internet zu stellen, Auszüge in Serie für eine gewisse Zeit online zu veröffentlichen, kostenlose PowerPoint- und Videoausgaben herauszugeben und über vieles mehr. Ich werde auf meinem Blog berichten, was dabei herausgekommen ist.
Coelhos Ansicht nach hat der kostenlose Internetzugang ihm mehr verschafft als den Verkauf seiner Bücher. Er schreibt gern in einem ganz anderen Tonfall auf seinem Blog. »Wahrscheinlich drücken Sie sich auf Ihrem Blog ganz anders aus, als wenn Sie für den Guardian schreiben, oder?«, sagte er, als ich für eine Kolumne des Guardian ein Interview mit ihm führte. »Wir müssen uns anpassen. Mir macht es großen Spaß, das zu tun.« Als ich ihn das erste Mal traf, behauptete er, sein Blog habe keinen Einfluss auf seine Bücher. Aber sechs Monate später, als er gerade sein neuestes Buch beendet hatte, sagte er, seine Leser hätten ihn hilfreich unterstützt, indem sie ihm das Thema Mode und die Anziehungskraft von Markennamen erläuterten.
Coelho twittert. Er benutzt einen ausklappbaren Camcorder, um Fragen für sein Publikum aufzuzeichnen und sie über Seesmic.com, eine Video-Gesprächsplattform, online zu stellen. Inspiriert von seiner Assistentin Paula Bracconot, die gut vernetzt und immer auf dem Laufenden ist, bat Coelho seine Fans, Fotos von sich zu machen, während sie seine Bücher lasen. Sie wurden in einer virtuellen Ausstellung auf der Frankfurter Buchmesse veröffentlicht, als Coelhos Bücher die 100-Millionen- Marke erreicht hatten. Hunderte schickten Fotos an Flickr. Beim ersten Mal, verkündete er auf seinem Blog, er werde die ersten Leser, die Interesse zeigten, auf eine Party einladen, die er in einem abgelegenen spanischen Städtchen feiern wollte. Aus aller Welt kamen Antworten, und er fürchtete, man würde von ihm erwarten, dass er für die Reisekosten aufkäme. Aber die Leser bezahlten ihre Tickets selbst, manche kamen sogar aus Japan. Zu einem anderen Anlass, der im Internet stattfand, kamen 10 000 Online-Besucher.
Coelho bat seine Leser, einen seiner Romane zu verfilmen: Die Hexe von Portobello. Mit The Experimental Witch forderte er die Menschen auf, die Geschichte der einzelnen Figuren seines Buches zu verfilmen. Sollten genug Leute diesem Wunsch nachkommen, so versprach er, werde er einen Cutter engagieren, um für den endgültigen Schnitt zu sorgen. Er tat auch Sponsoren auf – HP und MySpace –, um das Projekt zu finanzieren. Als die ersten Einsendungen ihn erreichten, schickte er mir die entsprechenden Links. Einige waren sehr aufwendig gemacht und zeigten beachtliches Talent.
Man beachte den roten Faden – kooperatives Zusammentragen von Nachrichten, den Nachrichten-Remix der BBC, die Gesangsparodien der Hörer von Howard Stern, die Lonely- Girl15-Videos und schließlich Coelhos Open-source-Film: Der Schaffensprozess an sich ist eine Community. Laut BookPublishing. com glauben 81 Prozent der Amerikaner, ein Buch in sich zu tragen. Keiner von ihnen wird jemals Coelho sein und Coelhos Bücher werden immer die seinen sein. Aber Kreativität inspiriert Kreativität, und das Internet ermöglicht es uns, daraus eine Unterhaltung zu machen. Die Moral von Coelhos Geschichte, wie von so vielen hier: Es geht um Beziehungen. Was hat das Internet ihm gegeben? »Es bereitet mir sehr viel Freude«, sagt er. »Denn, wenn man schreibt, ist man allein.« Jetzt nicht mehr. Online verfolgt er die Absicht, Beziehungen zu mehr Lesern aufzubauen und mehr Bücher zu verkaufen. Coelho glaubt nach wie vor an den Buchdruck. Liebevoll tätschelte er ein 3-D-Buch – eine dicke Biografie seines erfüllten Lebens – und sprach über die Perfektion dieser Form.
Verleger behandeln Google wie einen Feind, weil Bücher gescannt werden, damit man sie suchen kann (trotzdem kann man sie nicht von vorn bis hinten bei Google.com lesen). Stattdessen sollten Buchverlage Google und das Internet in die Arme schließen, denn jetzt entdecken immer mehr Leser über Suchanfragen und Links Autoren und das, was sie sagen. Sie bauen eine Beziehung zu ihnen auf und kaufen vielleicht ihre Bücher. Autoren erreichen hier einen immens großen Teil des Publikums, der niemals einen Buchladen betreten würde. Für Verleger und Autoren eröffnen sich neue Wege, Bücher ins Gespräch zu bringen. Bücher können länger überdauern und ihre Botschaften weitläufiger verbreiten. Das Internet wird Bücher nicht zerstören. Es wird sie verbessern. Nehmen Sie Coelhos Ratschlag für Verleger und Autoren an: »Haben Sie keine Angst.«
PS: Gerade, als ich das letzte i-Tüpfelchen dieses Manuskripts tippte, kündigte Google an, sie würden Verlegern und Autoren von vergriffenen Büchern die Möglichkeit eröffnen, Lesern, die online auf den gesamten Text zugreifen wollen, Gebühren in Rechnung zu stellen (Google wird 37 Prozent der Einnahmen als Provision einbehalten). Google könnte auch Anzeigen auf Internet-Buchseiten schalten und die Einnahmen mit Verlegern und Autoren teilen. Sergey Brin sagte in einem Blog des Wall Street Journal, das Gebührensystem ließe sich auf Videos, Musik und andere Medien ausdehnen.
Dieses Zugeständnis war ein Beitrag zur Schlichtung eines Rechtsstreits, den Verleger und Autoren angestrengt hatten, um Google daran zu hindern, Bücher zu scannen und sie online zugänglich zu machen – bisher liegen sieben Millionen Exemplare vor.
Es ist jedoch weit mehr als eine Maßnahme zur Besänftigung verärgerter Leute, die von Büchern leben. Mit einem Schlag veränderte Google den Lebens- und Wirtschaftszyklus von Büchern und entsprach möglicherweise einigen ihrer dringendsten digitalen Notwendigkeiten. Jetzt haben Bücher etwas Besseres zu erwarten als den Wühltisch voller Restauflagen und die Altpapiermühle. Man kann sie suchen. Sie werden ein neues Publikum über einen längeren Zeitraum und eine weitere Entfernung hinweg erreichen. Sie werden Geld einbringen. Google ist kein Feind der Bücher. Google wird zur Basisplattform ihrer Zukunft.
 Jeff Jarvis:
Jeff Jarvis:
Was würde Google tun“
Heyne Verlag 2009, 19,95 Euro, 416 Seiten










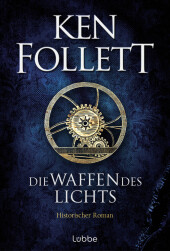
Die gefährlichste Firma der Welt
Herr X und Frau Y hatten gestern Abend Sex. Um sich anzuregen sahen sie sich einen Porno im Netz an und schauten danach noch genau 153 pornografische Bilder an, viele davon mit perversen Inhalten..
Herr X ist Beamter im Finanzministerium verheiratet, drei Kinder und Frau X ist nicht seine Ehefrau.
Frau X ist Sekretärin beim Bundesnachrichtendienst, sieht gerne Pilcher Verfilmungen ( wegen der schönen Landschaft ) über ihr Video on Demand Portal an und liest sich quer durch die Bestsellerliste. Frau Y bestellt ihre Reizwäsche bei Beate U. Zumeist Latex und Leder. Sie erwarb kürzlich eine Reitgerte ohne jemals ein Pferd besessen, geschweige denn geritten zu haben.
Herr X liebt es wenn man ihm des Popscherl verhaut. Mit Frau Y fand er die kongeniale Partnerin im Netz in einem einschlägigen Chatroom.
Herr X lädt sich gerne alte Jerry Cotton Romane aus dem Netz. Ebenso Bücher mit einschlägigen pornografischen Inhalten.
In seiner Freizeit, geht Herr X gerne fischen. Als begeisterter Hobbykoch bereitet er diese auch selber zu, zumeist nach Rezepten der berühmten Fernsehköche, die er sich bei diversen Fernsehsendern herunter lädt .
Und so weiter und so weiter, .Google kennt Herrn X und Frau Y genau .Google weiß bereits mehr als es wissen dürfte über die Beiden Google weiß was sie letzte Nacht getan haben
Heute schon !!
Und wir wollen es wirklich zulassen, das diese Firma in Zukunft weiß was wir lesen, sehen, hören, welche vorlieben wir haben und welche kleinen privaten Neigungen wir ausleben ?
Nach der Bankenkrise kommt die Gedankenkrise und ich möchte nicht das irgendwelche Leute die ich weder kenne und deren angeblich guten Absichten ich auf das heftigste bezweifle, in Zukunft all das von mir wissen. Die meine Gedanken kennen. Wehret den Anfängen STOPPT GOOGLE JETZT !!