Gelingt es den Verlagen, die richtigen Schlüsse aus dem Zusammenbruch der Musikindustrie zu ziehen? Nicht, wenn weiter Wunschdenken ihr Handeln bestimmt.
In einem Porträt des Über-Agenten Andrew Wylie wird er mit einer Aussage zitiert, die exemplarisch für das mangelnde Verständnis der Implikationen der Digitalisierung von Inhalten ist: so macht er die Musikindustrie selbst für ihren Zusammenbruch verantwortlich, weil sie ihre Profite an Apple abgegeben habe. Sein Argument: ohne Musik wäre ein iPod für Apple unverkäuflich gewesen und somit hätte die Musikindustrie „30 Prozent der iPod-Umsätze“ verlangen oder das Gerät durch die Verweigerung der Inhalte, die es erst wertvoll machen, zum Flop werden lassen können.
Exemplarisch für die Erkenntnisverweigerung ist diese Aussage aus zwei Gründen:
- Sie überträgt die in der Vergangenheit gültige Annahme, dass der Zugang zu Inhalten kontrollierbar sei, unreflektiert in die digitale Welt.
- Sie basiert nicht auf einer Analyse der Sachlage, sondern auf Wunschdenken, das die Fakten gezielt selektiv ausblendet, die das eigene Weltbild in Frage stellen könnten.
Reality Check:
- Kontrolle des Zugangs zu Inhalten
- Wunschdenken bestimmt Wahrnehmung
Für Produktion und Verbreitung von Inhalten waren im analogen Zeitalter umfangreiche Investitionen notwendig, die somit für alle möglichen Konkurrenten signifikante Eintrittsbarrieren darstellten. Dies ermöglichte die Kontrolle des Zugangs zu Inhalten. Anders in der digitalen Welt: selbst wenn sich J.K. Rowling beharrlich einer E-Book-Version von Harry Potter verweigert, um Piraterie zu vermeiden, war ihr Harry Potter 250.000 Mal illegal im Internet zu finden. Es muss sich nur eine einzige Person die Mühe machen, das Buch zu scannen und schon ist es allen, die Zugang zum Internet haben, kostenlos zugänglich. So waren und sind auch sämtliche Musikinhalte illegal und kostenlos zugänglich, ohne dass Kopierschutzmechanismen (DRM) oder Prozesse gegen Piraten und Verbreitungsplattformen etwas daran ändern konnten. Auch bei Büchern ist dies schon heute der Fall, obwohl elektronische Lesegeräte bislang noch nicht ein derartiges Massenphänomen wie der iPod sind. Inhaltsanbieter haben somit gar nicht die Wahl, ob ihr Content verfügbar sein soll – er ist es bereits. Sie können lediglich entscheiden, ob sie ihren Kunden auch eine legale Alternative bieten wollen.
Jeder, der die Entwicklungen im Musikmarkt auch nur am Rande verfolgt hat, wird mitbekommen haben, dass der iPod nicht erst durch die Verfügbarkeit eines breiten legalen Musikangebots via iTunes zum Erfolg wurde. Über eine Abfolge von P2P-Filesharing-Netzwerken wie Napster, Morpheus, Kazaa, Limewire und vielen anderen mehr versorgten sich iPod-Besitzer umfangreich mit Musik – lange bevor diese legal via iTunes erhältlich war. Die Verträge zwischen Apple und den Labels wurden also nicht aus dem Druck heraus geboren, dem nutzlosen Gerät iPod endlich dadurch einen Sinn zu geben, dass Musik verfügbar wurde, sondern vielmehr aus dem Zwang für die Labels, digital überhaupt irgendwie mitverdienen zu können. So wurden 2006 für jeden verkauften iPod nur 22 Songs legal via iTunes verkauft – weit entfernt von den 5.000 Songs, die ein 20 GB iPod speichern kann und den 842 gestohlenen Songs, die ein Jugendlicher 2008 im Schnitt auf seinem iPod gespeichert hatte. Diese Fakten wurden in den Medien so breit kommuniziert, dass auch Andrew Wylie sie nicht übersehen haben kann. Dass die Labels also in der Lage gewesen wären 30 Prozent der iPod-Umsätze von Apple zu verlangen oder ihre Verweigerung den iPod wertlos gemacht hätte, ist somit eine bewusste Verdrehung der Tatsachen. Soll das eigene Geschäft in einer digitalen Welt noch eine Existenzgrundlage haben, ist Wunschdenken sicher der schlechteste Berater.
Clay Shirky bringt das beschriebene Wahrnehmungs-Dilemma am Beispiel von Medienmogulen auf den Punkt, die vehement die direkte Bezahlung ihrer Inhalte einfordern:
„Diller, Brill und Murdoch scheinen nur ein Naturgesetz zu erwähnen – wir müssen sie bezahlen – aber tatsächlich ist diese Tatsache keine Tatsache. Stattdessen handelt es sich um eine Option, die ihre Befürworter nur ungern aussprechen, da sie sich sonst wie folgt lesen würde: „Internet-User müssen für das, was sie sich anschauen und benutzen, bezahlen, sonst sind wir gezwungen aufzuhören, Inhalte so teuer und komplex zu produzieren, wie wir es gewohnt sind. Und wir wissen nicht, wie das geht.““ http://www.shirky.com/weblog/2010/04/the-collapse-of-complex-business-models/
Um herauszufinden, wie dies geht und welche Komponenten künftig die Existenzgrundlage von Medienunternehmen sein können, sollten die Konzernlenker also nicht an den Lippen von Auguren hängen, die Wunschdenken als Tatsachen proklamieren, sondern pragmatisch unterschiedlichste Modelle ausprobieren, um die erfolgsversprechenden Bestandteile eines neuen Regelwerks zu identifizieren.



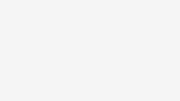








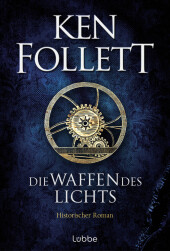
Kommentar hinterlassen zu "Alexander Braun: Wunschdenken ist ein schlechter Berater"