Stephan Porombka hat die ostdeutsche Literaturszene erforscht. Bei der Literaturvermittlung sieht er zu wenig Anreize für ein jüngeres Publikum.
Wie steht es um die Literaturszene in Ostdeutschland?
Im Allgemeinen ist die Literaturszene unglaublich aktiv und vielfältig. Es ist überraschend, wie viel sich dort tut, vor allem wenn man bedenkt, dass der Großteil auf ehrenamtlichem Engagement gründet.
In Ihrer Studie diagnostizieren Sie aber eine gewisse Rückständigkeit …
Rückständigkeit ist nicht der richtige Begriff. Das klingt ja, als hätte die Situation etwas mit der Zeit vor 1989 zu tun. Hat sie aber nicht. Die Probleme sind aktueller: Erstens hat die föderalistische Struktur dafür gesorgt, dass alle Länder jeweils für sich arbeiten. Es gibt keine Vernetzung und kein zentrales Nachdenken, was sich mit Literaturförderung anfangen lässt. Zweitens werden wenig öffentliche Gelder für Literatur zur Verfügung gestellt, anders als für Theater, Kunst und Musik, die in der Regel 98% der Kulturhaushalte zugeschoben bekommen. Die Finanzierung ist meist so schlecht, dass sich viele Projekte gar nicht über einen längeren Zeitraum am Leben halten können. Drittens hat das, was an Konzepten verwirklicht wird, grundsätzlich etwas, was ich einen unauratischen Umgang mit Literatur nenne: Da ist alles doch sehr protestantisch, sehr karg, wenig Inszenierung. Und das heißt: Es gibt alles in allem wenig Anreize vor allem für jüngere Leute, sich auf Literatur einzulassen. In diesem Punkt ist die Literaturvermittlungsszene in den neuen Ländern in der Tat eher rückständig, weil das, was dort betrieben wird, kaum auf die Gemengelage reagiert, mit der sich die Literatur in der Mediengesellschaft auseinandersetzen muss.
Was sind die Unterschiede zur Literaturlandschaft in den alten Bundesländern?
Auch für den Westen gilt das Prinzip der Unterfinanzierung. Ein wichtiger Unterschied betrifft das bürgerschaftliche Engagement: Sie finden in den alten Bundesländern ein deutlich stärkeres Engagement bei der Unterstützung einzelner Literaturinstitutionen. In den neuen Bundesländern gibt es dagegen keine Sponsorenkultur, weil die Unternehmen, die Kultur fördern, dort meistens nur Dependancen haben und allein in die Projekte am Hauptsitz investieren.
Welchen Beitrag können Verlage leisten?
Verlage treiben die Dynamisierung des literarischen Lebens voran, Verlagsstädte sind immer auch Städte mit einer sehr lebendigen literarischen Szene. Diese kulturellen Zentren fehlen in den neuen Bundesländern: Die Verlagslandschaft in der DDR ist zusammengebrochen, das hat der Verleger Christoph Links in seiner Studie sehr präzise analysiert. Es gibt keine eigene regional orientierte Verlagsstruktur: Viele Unternehmen sind von westlichen Verlagen übernommen und z.T. einfach eingestellt worden. Allmählich gibt es die Entwicklung, dass sich kleinere Verlage wieder mit Gegenwartsliteratur beschäftigen und sie nicht nur fördern, sondern auch hervorbringen. Aber das sind alles eher kleinere Projekte, die Zeit und vor allem sehr viel Unterstützung brauchen
Und der Buchhandel?
Buchhandlungen sind gerade für die Literaturvermittlung wichtige Bezugsorte, die zum Teil die Bedeutung von kleinen Literaturhäusern erlangt haben. Das gelingt aber nicht den großen Buchketten, es sind vor allem die kleineren Kiez- oder Stadtteilbuchhandlungen, die ein viel profilierteres Programm haben. In unseren Gesprächen haben die Mitarbeiter der Literaturinstitutionen immer mit sehr viel Respekt von den Buchhändlern gesprochen, sie gleichzeitig aber auch als Konkurrenz wahrgenommen. Das gilt im Gegenzug für manche Buchhändler, die kritisieren, dass Institutionen öffentliche Gelder bekommen, während ihre eigenen Veranstaltungen natürlich nicht bezuschusst werden. Allerdings gibt es zwischen den öffentlich geförderten Institutionen der Literaturvermittlung und den Buchhandlungen auch viele Kooperationen, und ich glaube, dass es da noch eine Menge Potenzial gibt, um auch in Zukunft gemeinsame Veranstaltungen zu entwickeln.
Was müssen die literarischen Institutionen in den neuen Ländern ändern?
Das ist eine schwierige Frage, denn die derzeitige Situation liegt ja auch an der Unterfinanzierung. Die Mitarbeiter in den Literaturinstitutionen müssen meist auf einer Stelle Öffentlichkeitsarbeit, Finanzbuchhaltung, Programmplanung, Autorenbetreuung usw. übernehmen. Die haben den Kopf nicht wirklich frei, um sich weiterzuentwickeln. Andererseits stellt sich für diese Institutionen schon die grundsätzlichere Frage, welche Aufgabe die Literaturvermittlung noch übernehmen soll. Wenn man Leseförderung betreiben will, muss man sich wohl oder übel mit der Medienkonkurrenz auseinandersetzen. Das heißt, man muss dann auch systematisch ganz andere Formen von Literatur einbeziehen, z.B. auch Trivialliteratur, Comics und Hörspiele. Und man muss dem Umstand Rechnung tragen, dass Literatur mittlerweile anders konsumiert wird, nämlich nicht als zentrales Bezugsmedium, sondern als ein Medium unter anderen: mit Musik, mit Film, mit Internet. Diese multimedialen Zusammenhänge müssen in aktuellen Konzepten reflektiert werden.
Sie fordern zeitgemäßere Formen der Literaturvermittlung.
Ja, unbedingt. Es wird zunehmend wichtig, Literatur weniger im reinen Sinn zu denken und sich stattdessen stärker gegenüber den anderen Künsten und Medien zu öffnen, um vor allem auch ein jüngeres Publikum zu gewinnen.
Muss Literatur immer zum Event werden?
Nein, man kann natürlich immer noch Wasserglaslesungen machen. Aber man muss sich klar sein, dass hinter der klassischen Autorenlesung doch ein recht alter Literaturbegriff steht, der vorgibt, dass man sich in die einzelnen Werke versenken muss, die Stimme des Autors hören muss, um dicht am Eigentlichen und Wesentlichen des Textes zu sein. Das ist die gute alte protestantische Literaturkirche: Wir gehen rein, hören schweigend die Predigt und gehen dann nach Hause. Das ist ein Literaturbegriff, der aus der Perspektive der Mediengesellschaft überholt ist, weil er nicht den gegenwärtigen Umgängen mit Texten entspricht. Man kann das natürlich ignorieren. Aber dann koppelt man sich von der Gegenwart ab und kann sie nicht einmal mehr kritisch beobachten.
Was wird aus Dichtern mit schlechter Bühnen-Performance?
Es bedeutet ja nicht, dass man ab jetzt immer die Showtreppe und den künstlichen Nebel braucht. Schon allein um eine schlichte Lesung anders zu gestalten, braucht es doch nur wenige Handgriffe: Man kann z.B. Texte gegeneinanderstellen oder auch ihre Entstehung veranschaulichen. Solche Veranstaltungen wären dann nicht nur rezeptiv, sie hätten auch ein produktives Moment – und sie wären damit dem Energiekern der Literatur viel näher.
Zur Person: Stephan Porombka
1967 in Salzgitter geboren ist Professor für Kulturjournalismus und Literaturwissenschaft an der Universität Hildesheim. Nach dem Studium der Germanistik, Politik- und Theaterwissenschaft promovierte er 1999 mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes. 2003 wurde er Juniorprofessor, ab 2007 Universitätsprofessur für Literatur und Kulturjournalismus. Gemeinsam mit dem Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil leitet er den Studiengang „Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus“. Seine Forschungsschwerpunkte sind Literatur & Journalismus, Sachbuchforschung und angewandte Literaturwissenschaften.







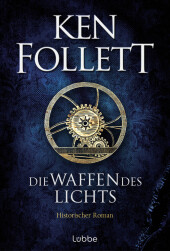
Kommentar hinterlassen zu "Hat die Lesung ausgedient, Herr Porombka?"