
Am heutigen Donnerstag, 1. Dezember 2011, 11 Uhr, ist Christa Wolf im Alter von 82 Jahren in Berlin gestorben.
buchreport.de blickt mit einem großen Interview mit der Schriftstellerin aus dem Jahr 2001 auf ein ereignisreiches Leben und facettenreiches Werk zurück. Es geht um Vergangenheit und Vision, Emanzipation und Globalisierung, Bücher und Leser.
Wenn Sie in den Bänden Ihrer Werkausgabe blättern, finden Sie dann bestätigt, was Sie zu Beginn der Kassandra geschrieben haben? Dort heißt es: „Hier ende ich ohnmächtig und nichts, nichts was ich hätte tun oder lassen, wollen oder denken können, hätte mich an ein anderes Ziel geführt.“
Kassandra ist eine literarische Figur, starken Schicksalszwängen unterworfen, die sie allerdings durch eigene und eigenwillige Entscheidungen bis zu einem gewissen Grad aufbricht. Ich habe oft daran gedacht, dass ich ein anderes Leben hätte führen müssen, um an ein anderes „Ziel“ zu kommen. Und das wäre leicht möglich gewesen. Wenn es meiner Familie – wir waren damals auf einem Flüchtlingstreck von jenseits der Oder – und damit auch mir im Frühjahr 1945 gelungen wäre, was wir mit aller Kraft versuchten: von der näher rückenden russischen Front weg ins schon amerikanisch besetzte Gebiet zu kommen. Wir haben es nicht geschafft, sondern sind vorher eingeholt worden, zunächst von den amerikanischen Truppen, aber eben vor der Elbe, in jenem Gebiet, das wenig später von sowjetischen Truppen besetzt wurde. Wenn ich jenseits der Elbe gelandet wäre, in der englischen oder amerikanischen Zone – ich könnte nicht sagen, wie dann mein Leben verlaufen wäre; ob ich zum Beispiel überhaupt geschrieben hätte. Von solchen Zufällen waren ja deutsche Lebensläufe nach Kriegsende mit bestimmt.
Sie beziehen sich in Ihrem Zitat aus „Kassandra“ auch darauf, dass Sie von Ihrem bewussten Leben her nur das gemacht haben, was Sie machen wollten.
Darüber müsste ich länger nachdenken. „Nur das gemacht“ – wer könnte das von sich sagen? Aber: Im Großen und Ganzen würde ich mir kein anderes  Leben wünschen, denn dann müsste ich mir auch andere nahe Menschen wünschen, und das kann ich nicht, darin habe ich großes Glück, und diese Menschen prägen ja entscheidend das Leben. In meiner Arbeit habe ich wirklich nur das gemacht, was ich wollte. Und die wichtigsten Etappen meiner Entwicklung kann ich mir auch kaum anders vorstellen, sie waren mir gemäß.
Leben wünschen, denn dann müsste ich mir auch andere nahe Menschen wünschen, und das kann ich nicht, darin habe ich großes Glück, und diese Menschen prägen ja entscheidend das Leben. In meiner Arbeit habe ich wirklich nur das gemacht, was ich wollte. Und die wichtigsten Etappen meiner Entwicklung kann ich mir auch kaum anders vorstellen, sie waren mir gemäß.
Ihre Werkausgabe, chronologisch angelegt, wirkt wie ein langer Lebenslauf. Man fragt sich bei der Lektüre: Was war zuerst, das Leben oder die Arbeit?
Das Leben. Eindeutig. So möchte ich spontan antworten. Ich frage mich aber auch: Kann ich das überhaupt trennen?
Haben Sie mit Ihrer Arbeit auf das Leben reagiert?
Ich habe diese Arbeit gebraucht, um zu leben. Die Erfahrungen, Erschütterungen, Aufregungen meines Lebens habe ich schreibend reflektiert. Und dann hat wiederum mein Schreiben mein Leben bestimmt. Ich hätte anders gelebt, wenn ich nicht geschrieben hätte.
Sie haben ein „öffentliches“ Leben geführt, sind eine „öffentliche“ Person geworden. Wer Ihr Werk kennt, kennt auch Sie. Stört Sie das?
Schwer zu beantworten. Eigentlich stört es mich, ja. Ich habe immer große Teile meines privaten Lebens aus der Öffentlichkeit herausgehalten, aber ich bin mir nach und nach darüber klar geworden, dass ich nicht anders schreiben kann als mit dem Einsatz meiner ganzen Person. Da entsteht dann bei jedem neuen Text, den ich glaube fertig zu haben, die Frage: Soll ich das überhaupt veröffentlichen? Offenbare ich da nicht zu viel von mir? In diesem Sinne „öffentlich“ zu sein, ist und bleibt für mich schwierig. Ich glaube, um dieses Wagnis immer wieder einzugehen, ist die Hoffnung auf eine Grund-Sympathie der Leser wichtig. Nicht Übereinstimmung, das nicht; menschliche Sympathie.
Da Sie eine politische Autorin sind, ist mit Ihrer Arbeit zwangsläufig ein Mitteilungsdrang verbunden. Die Reaktion auf gesellschaftliche Ereignisse drängt darauf, veröffentlicht und ihrerseits diskutiert zu werden. Treibt Sie dieser Mitteilungsdrang?
Der ist in verschiedenen Perioden meines Lebens verschieden stark gewesen. Augenblicklich habe ich diesen Mitteilungsdrang weniger als früher zu bestimmten Zeiten.
Als Sie 1990 Ihre Reaktion auf die Wende veröffentlicht haben („Was bleibt“), haben Ihnen Kritiker gesagt, Sie hätten damit getrost warten sollen.
Das haben sie gesagt. Vielleicht hätte ich das machen sollen. Aber damals – Ende 1989 – kannte ich noch nicht den neu erwachten Eifer der Medien, den Autoren, die in der DDR geblieben waren, zu große Staatsnähe nachzusagen und das, was ich beschreibe, für unglaubwürdig zu erklären. Aber im Herbst 1989 ging es ja bei unseren öffentlichen Äußerungen im Allgemeinen nicht um literarische Texte. Das war ein Zeitpunkt, da eine revolutionäre Umwälzung in Gang gebracht wurde, von „unten“ her, so dass wir Autoren uns aufgefordert sahen, uns einzumischen – teils, indem wir die Anliegen und Forderungen der Demonstrierenden formulierten, teils, indem wir ausdrückten, was wir selbst zu unserer Geschichte und zu den Entwicklungen der Gegenwart zu sagen hatten. Auf einmal hatten wir auch die Tribüne; ich hätte ja vorher im DDR-Rundfunk oder -Fernsehen nicht auftreten können. Jetzt konnte, ja sollte ich es sogar; das habe ich in einer Reihe von Fällen ausgenutzt, übrigens in dem Bewusstsein, dass diese Periode, da unsere Worte eine Wirkung hatten, schnell vorbeigehen würde. In der DDR verlief die öffentliche Wirkensmöglichkeit von Schriftstellern in Wellenbewegungen. Es gab Perioden, in denen mein Mitteilungsbedürfnis und auch das anderer Autoren fast nur auf die Literatur verwiesen war. Direkt tagespolitisch konnten wir uns nur wenig äußern. Trotzdem sind meine Arbeiten gerade in solchen Zeiten sehr „politisch“ und wurden auch so verstanden: „Kassandra“ zum Beispiel, „Kein Ort. Nirgends“, oder „Störfall“. Politische Abstinenz habe ich nie geübt.
Es gibt auch impulsive Reaktionen, so z. B. auf 1965 vor dem Plenum des Zentralkomitees der SED, als Sie unvorbereitet auf die Kulturattacke der Partei reagiert haben.
Ja, das war so ein Moment. Es gibt zwei, drei Momente innerhalb meiner Entwicklung in der DDR, in denen ich mir bewusst war: Wenn ich jetzt nicht auftrete, dann kann ich nicht mehr schreiben. Dann wäre mein eigener Anspruch, den ich an Wahrhaftigkeit habe, so in Frage gestellt, dass ich im Schreiben blockiert wäre. Das war so ein Punkt. Es war auch sehr wichtig, dass mich die Leute um mich herum dazu ermutigt haben. Außerdem war niemand anderes da, der sich vor das versammelte Zentralkomitee hingestellt und widersprochen hätte. Also musste ich reden, obwohl ich wusste, dass es in diesem Gremium eigentlich keinen Widerspruch geben durfte.
Ihr essayistischer Stil ist ziemlich einzigartig geblieben. Brauchen Sie für diese Art des Schreibens realistische Ereignisse und Entwicklungen, auf die sie reagieren?
Das ist nicht immer gleich. Es gibt Texte, bei denen ich sagen würde, sie sind weniger essayistisch, z.B. „Kein Ort. Nirgends“, „Sommerstück“ oder auch die Erzählungen „Kassandra“ und „Medea“.
Der Zusatz „Roman“ steht nur unter einem Ihrer Werke – bei „Medea“.
Das hängt mit dem Umfang der Texte zusammen und eben mit ihrer Struktur: Sie sind nicht umfangreich genug oder an eine Fabel gebunden, um sie „Roman“ zu nennen. Dieses Genre ruft ja gewisse Assoziationen hervor.
Könnte Sie eines Tages die große Form reizen?
„Kindheitsmuster“ ist für mich „große Form“. Aber Sie meinen die „geschlossene“ Form? Ich weiß gar nicht, ob die mir „liegt“. Ich habe öfter Texte, die dann später lang geworden sind, z.B. eben auch „Kindheitsmuster“, in traditioneller Manier oder in der dritten Person angefangen zu schreiben, es ist mir nie gelungen. Ich kam immer wieder zu einer Erzählweise, die mir die Möglichkeit der Reflexion gab und ein nichtchronologisches Erzählen erlaubte oder erzwang – ein Erzählen, das ein Netz, eine Art Gewebe über dem Stoff ausbreitet und ihn darin einfängt, einbettet, „an Land zieht“.
In Verbindung mit „Medea“ haben Sie gesagt, dass Sie Stimmen gehört hätten, die Sie beim Schreiben vorwärts getrieben haben. Das wäre ja ein Signal für einen Roman.
Ja, ich habe die Figuren sprechen hören, das hat mich zu dieser Form gebracht.
Ihr Leben hat sich verändert, insbesondere in den letzten zehn Jahren. Man könnte sich vorstellen, dass Ihre Reaktionen anders werden. Sie müssen nicht mehr auf jedes Ereignis eine literarisch überhöhte Antwort geben, Sie könnten auch eine eigene Welt entwickeln. Von Utopien ist bei Ihnen ja oft die Rede.
„Utopien“ als Zukunftsentwürfe? Ich habe noch zu tun mit der inneren Auseinandersetzung um die „versunkene Welt“, in der ich den größten Teil meines Lebens verbracht habe, mit sehr viel Engagement und Beteiligung. Ich weiß noch nicht, wohin der Weg mich führt und ob ich dann frei sein werde für eine neue Vision. Im Moment scheint es so, dass noch eine ganze Menge zu sagen, zu erzählen und zu bedenken ist aus der Zeit, die wir angeblich hinter uns haben, die aber die Menschen überhaupt noch nicht bewältigt haben. Ich meine, dass ich zu denen gehöre, die die Pflicht haben, über unsere Geschichte etwas zu sagen, es in der Erzählung „aufzuheben“. Es wird alles schnell vergessen, es geht alles zugrunde. Wir müssen aufschreiben, wie wir, wie die Leute gelebt haben, auch was sie gedacht, geglaubt, gehofft haben und wie die damit verbundenen Lebenshaltungen und Strukturen beschaffen waren. Man kann natürlich sagen – und diese Auffassung hat es immer gegeben –, es kommt eine neue geschichtliche Epoche, dann geht das Alte eben zugrunde. Als sich die österreichisch-ungarische Monarchie auflöste, war das für manche Autoren schmerzlich und hat zu Depressionen geführt. Andererseits ist aus diesem Schmerz große Literatur entstanden.
Sie messen dem Schriftsteller auch in Zukunft eine Schlüsselfunktion in der Gesellschaft zu. Muss dann auch die Entwicklung von Perspektiven und Utopien zu den Aufgaben des Schriftstellers gehören?
Ich bin mir hinsichtlich dieser Schlüsselfunktion nicht mehr sicher. Der Einfluss von Autoren und Autorinnen auf gesellschaftliche Entwicklungen ist doch viel marginaler geworden. Das ist auch eine Entlastung. Ich weiß nicht, was und ob etwas an die Stelle der Literatur tritt, der von der Aufklärung her ja ein gewisses Recht, auch die Pflicht zugewachsen war, neue Wertvorstellungen und Normen zu formulieren. Eine andere zentrale Instanz? Ideologien? Parteien? Die Kirchen? Das sehe ich im Moment nicht. Vielleicht wird künftige Orientierung von Gruppen von Menschen aus verschiedensten Sachund Fachgebieten ausgehen. Darunter könnten auch Schriftsteller sein. Unsere Empfangs-Antennen sind aber zur Zeit kaum darauf eingestellt, auf leise, nachdenkliche Stimmen zu lauschen.
Überfordern die vielfältigen Entwicklungen den Autor?
Die Zeit, in der ein Autor zugleich in der Biologie und in der Physik, in der Gesteinskunde und anderen Disziplinen seiner Zeit fachkundig sein konnte, sind lange vorbei. Es ist wahr – auf verschiedene schwierige Fragen, die in letzter Zeit diskutiert werden und in denen ich keine Fachkenntnisse habe, spüre ich in mir oft die Antwort aufsteigen: Ich weiß es nicht. Da ist der Autor nicht urteilsfähiger als ein anderer gebildeter Zeitgenosse. Andererseits: Auch in einer durchtechnisierten Welt stellt sich für viele Menschen nicht nur das Problem, die tödliche Langeweile zu vertreiben, sondern auch die Sinnfrage. Für beide fundamentalen Bedürfnisse ist Literatur gefragt. Und es kann ja sein, dass die Einsicht zunimmt, dass eine starke Subjektivität und der Mut, sie auszudrücken, auch in einer auf Effizienz getrimmten Gesellschaft unverzichtbar sein können.
Wagen sich Autoren nicht mehr an schwierige Themen heran?
Das liegt, falls es zutrifft, in der Zeit. Die Verlockung der Spaßgesellschaft ist groß, vielleicht auch die Verlockung, dem Hang zur Beliebigkeit nachzugeben. Ich kann die Situation bei jüngeren Autoren nicht so genau beurteilen; uns Älteren sind durch unser Leben bestimmte Verhaltensweisen und Themen „eingebrannt“, die ich schon unter die „schwierigen“ rechnen würde. Und denen entziehen wir uns auch nicht.
Sie haben die Funktion des Autors früher anders formuliert: „Die Prosa kann sich nur mit gedanklichen Strömungen und gesellschaftlichen Bewegungen verbinden, die der Menschheit eine Zukunft geben, die frei sind von jahrhundertealten und den brandneuen Zauberformeln der Manipulierung und selbst das Experiment nicht scheuen.“
Wo sind diese Bewegungen?
Dann müsste ich Sie fragen, wo stehen in diesem Zusammenhang die Autoren?
Das hängt miteinander zusammen. Wenn Sie in der deutschen Geschichte zurückschauen und die Verquickung von Literatur und Autorengeschichte mit politischer Geschichte betrachten, dann gab es Aufschwünge in der Literatur, progressive literarische Bewegungen im Zusammenhang, oft als Vorläufer gesellschaftlicher Aufschwünge, zum Beispiel des Bürgertums im 18. Jahrhundert, aber es gab auch große Literatur in Zeiten der Rezession, wenn die deutsche Misere sich voll entfaltete und die Schriftsteller, wie Anna Seghers sagt, sich „ihre Stirnen an der gesellschaftlichen Mauer wundrieben“. Im Augenblick erleben wir keine solche Zeit. Aus sich selber heraus können Autoren politische Bewegungen nicht schaffen. Sie können sie erspüren, geistig mit vorbereiten, sich ihnen anschließen – wie Ende der 80er Jahre in der DDR, als deutsche Autoren in die überaus seltene Lage kamen, an einer progressiven gesellschaftlichen Bewegung mitzuwirken. Ich sehe im Moment nicht, aus welchen Kreisen oder Kräften eine solche Bewegung entstehen könnte. Insofern präsentiert sich Literatur zur Zeit meist privat.
Ihr Werk ist auch eine Auseinandersetzung zwischen männlicher und weiblicher Sicht. Sehen Sie auch hier einen Stillstand?
In den letzten 40 Jahren, besonders in den letzten 20 Jahren hat die feministische Bewegung eine Menge von Wissen über die Rolle der Frauen in der Geschichte gebracht, auch über ihre Unterdrückung und die Gründe dafür. Meine Beschäftigung mit weiblichen Protagonistinnen der vorgeschichtlichen Zeit hat damit zu tun. Es hat im Zusammenhang mit dieser Bewegung einen großen emanzipatorischen Aufschwung gegeben. Dieser Boom geht zur Zeit zurück, schon errungene Positionen werden in Frage gestellt oder aufgegeben, aber die Frauen werden sich nicht wieder auf ihre früheren Positionen zurückdrängen lassen. Zur Zeit beobachtet man ein starkes Bedürfnis von Frauen, ihre Karriere zu managen, also sich an männliche Verhaltensnormen anzupassen; vielleicht wird es wieder einmal eine jüngere Frauengeneration geben, die das ablehnt. Jedenfalls ist das, was die Autorinnen in der Frauenbewegung des 20. Jahrhunderts gemacht haben, nicht umsonst gewesen, daran wird Frau und Mann anknüpfen können.
Hat die Entwicklung der letzten Jahrzehnte auch die persönlichen Beziehungen von Männern und Frauen verändert?
Die Entwicklung hat für eine Reihe von persönlichen Beziehungen zwischen Männern und Frauen Veränderungen gebracht, die vor 20 oder 30 Jahren nicht vorstellbar gewesen wären: mehr Freiheit, wirkliche Gleichberechtigung in intimen Beziehungen. Ein neuer Männer-, ein neuer Frauentyp hat sich entwickelt. Dem arbeitet nun der gesellschaftliche Trend strikt entgegen: Im Zuge der Globalisierung nimmt die Aggressivität zu, ökonomische Maßstäbe dringen in alle Verhältnisse vor, das heißt, Konkurrenzdenken und Profitstreben bestimmen mehr und mehr auch die Freundschaften, die Liebesbeziehungen zwischen Männern und Frauen, eine umfassende, neue Gewichtung der Werte ist im Gange. Dies wird zunehmend wahrgenommen, von Männern und Frauen, aber die Gefährlichkeit dieses Prozesses wird überdeckt, weil es uns ja noch so gut geht. Doch von den Rändern her und nun auch immer mehr aus der Mitte heraus wird unsere Wohlstandsinsel angegriffen. Nicht nur die Vorgänge in Seattle und Genua, aber zuletzt eben die, stellen den Turbokapitalismus in seinem Kern in Frage. Es scheint, als würden wir die Konsequenzen aus dieser Diagnose der nächsten Generation, der Jugend zuschieben.
Und was bewirkt Literatur in einer solchen Situation?
Es gibt doch Menschen, die an Literatur und Kunst ihre Persönlichkeit formen, ihr Weltbild ausrichten, ihre Wertvorstellungen überprüfen. Ich habe den Eindruck, das ist eine kleine Gilde, die bleiben wird, davon bin ich überzeugt. Aber ihre öffentliche Wirkung nimmt zur Zeit ab. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich mich in solchen Prognosen schon öfter geirrt habe. Dass die Kräfte stärker werden, die leben und nicht mit untergehen wollen in diesem Wirtschaftsstrudel, das will ich doch für möglich halten. Es geht immer noch und immer wieder um die Bewahrung des Humanen: Und dies ist ja auch der Kern von Literatur.
Dann würde der autonome Autor auch nicht viel bewirken können.
Der autonome Autor alleine vielleicht nicht. Ich bin immer schon dafür gewesen, dass Netzwerke von Menschen entstehen, die sich untereinander informieren, sich gegenseitig ermutigen und sich um ein bestimmtes Anliegen zusammenfinden. Ich sehe, dass es inzwischen viele solcher Gruppen gibt, z. B. auf dem Lande in Mecklenburg, wo ich im Sommer lebe und wo man es vielleicht gar nicht vermutet, trifft man auf Gruppen von Menschen, auch jüngeren Menschen, die sich um ein bestimmtes Ziel herum finden und sei es, dass sie eine alte Scheune zu einem Kulturmittelpunkt machen wollen.
Hat sich also die theoretische Auseinandersetzung mit Veränderungen in der Gesellschaft, wie Sie von Ihnen z. B. in „Nachdenken über Christa T.“ ausgelöst worden ist, in eine sehr handfeste, realitätsbezogene Diskussion verändert?
Ja. Die Menschen, die sich heute konkret um irgendetwas in der Gesellschaft kümmern, haben eine starke Persönlichkeit, sind „authentisch“, dabei sehr subjektiv und gleichzeitig sehr praktisch.
Wie beurteilen Sie diese aktuellen Entwicklungen, wenn Sie in Verbindung mit Ihrer Werkausgabe noch einmal 40 Jahre Ihres Lebens und Ihrer Arbeit Revue passieren lassen?
Ich habe vor Erscheinen eines jeden Bandes die Texte Korrektur gelesen. Das waren oft ganz eigenartige Erlebnisse. Ich hatte vieles vergessen und habe nun festgestellt, dass man nicht nur bei den erzählenden Texten, sondern gerade auch in den Essays, Reden, Briefen, Artikeln eine Art Zeitreise antritt. Zum Beispiel erfährt man in dem vorläufig letzten Band, dem Band 12, der im Herbst erscheinen wird, wie ich glaube eine Menge darüber, wie der Prozess der deutschen Wiedervereinigung aus meiner Sicht, die ja nicht nur eine „ostdeutsche“ ist, verlaufen ist. Manche dieser Texte sind mir abgefordert worden, zu manchen habe ich mich nur zögernd entschließen können. Nun bin ich froh, daß ich das alles aufgeschrieben habe. Es schließt sich jetzt zusammen zu einem vielleicht sogar spannenden Zeitdokument.
Sie haben einmal geschrieben, es wäre Ihr Anliegen, alles zu sagen, ohne Überhang von Ungesagtem. Haben Sie das geschafft?
Nein, da ist immer noch ein Überhang von Ungesagtem, der mich zum Weiterschreiben treibt.
Sie haben mit dem Schreiben immer auch die von Ihnen selbst formulierte Sehnsucht nach Selbstverwirklichung verbunden. Sehen Sie diesen Anspruch jetzt, da die 12 Bände Ihrer Werkausgabe einen Überblick geben, erfüllt?
Das Schreiben war meine Möglichkeit, mich zu verwirklichen, tätig und wirksam zu sein. Die anderen Möglichkeiten waren die als Frau und die als Mutter, die für mich elementar wichtig hinzukommen. Ich könnte mir keinen anderen Beruf vorstellen, in dem ich mich ähnlich „zu Hause“ gefühlt hätte. Insofern habe ich Glück gehabt.
Ihre Werkausgabe wird als „Leseausgabe“ annonciert. Verbinden Sie damit eine bestimmte Vorstellung?
Mir ist klar, dass eine Werkausgabe kaum ein Massenpublikum findet. Ebenso klar ist, dass es häufig Menschen sein werden, die sich mit Literatur auseinandersetzen wollen, Germanisten, Studenten, Bibliothekare, Lehrer et cetera, die mit dieser Werkausgabe arbeiten wollen, die weitere Informationen bekommen, vor allem durch die Nachworte und Anmerkungen von Sonja Hilzinger, die sehr viel aufarbeiten konnte in meinem Archiv und vieles über Vorarbeiten und Zusammenhänge schreibt, was man vorher nicht wusste. Was nur eine Hoffnung bleiben kann, ist, ob der so genannte „normale“ Leser, der vielleicht das eine oder andere dieser Bücher schon hat, sich diese Werkausgabe in seinen Bücherschrank stellen wird. Man kann ihn nur dazu einladen, man kann es ihm möglichst erleichtern – das meint der Verlag mit „Leseausgabe“. Durch die sorgfältige Aufbereitung der Texte, durch Genauigkeit und durch Kommentierung ist sicher ein zusätzlicher Gewinn für Leser entstanden.
Wie gefällt ihnen die chronologische Anordnung Ihrer Arbeiten?
Diese Chronologie ermöglicht es, den inneren Bogen in meinen Arbeiten über die Jahrzehnte hin wahrzunehmen, ihre innere Logik. Mir gefällt das sehr.
Im Februar wird man seit „Medea“ wieder eine größere Erzählung von Ihnen lesen können: „Leibhaftig“. Können Sie einen Ausblick geben?
Es ist ein Text, der sich mit einer Krisensituation auseinander setzt, in der eine Ich-Erzählerin sich mit einer körperlichen und zugleich mit einer existenziellen Krise konfrontiert sieht. Eine Erzählung, wenn sie wollen, nicht sehr lang – ich bin gerade dabei, die letzten Korrekturen zu machen.
Fragen: Bodo Harenberg
Zur Person: Christa Wolf
18.3.1929 Geboren in Landsberg/Warthe (Gorzów Wielkopolski) Grundund Oberschule in Landsberg
1945 Umsiedlung nach Mecklenburg
1949 Abitur in Bad Frankenhausen (Kyffhäuser)
Beitritt zur SED
1949-53 Studium der Germanistik in Jena und Leipzig.
Diplomarbeit bei Hans Mayer.
1953-59 Wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Schriftstellerverband in Berlin. Lektorin
Redakteurin der Zeitschrift „neue deutsche literatur“
Cheflektorin des Verlags Neues Leben
1959-62 Lektorin des Mitteldeutschen Verlags in Halle
1963 Freie Schriftstellerin
„Der geteilte Himmel“ · Erzählung; Mitteldeutscher Verlag
1968 „Nachdenken über Christa T.“; Mitteldt. Verlag (Luchterhand 1969)
1972 Lesen und Schreiben · Aufsätze und Betrachtungen Aufbau-Verlag (Luchterhand 1972)
1976 Kindheitsmuster; Aufbau-Verlag (Luchterhand 1977)
1979 „Kein Ort Nirgends“; Aufbau-Verlag (Luchterhand 1979)
„Fortgesetzter Versuch“ · Aufsätze, Gespräche, Essays; Reclam Verlag
1980 „Gesammelte Erzählungen“; Luchterhand
1983 „Kassandra“ · Erzählung; Luchterhand, Darmstadt (Kassandra. Vier Vorlesungen. Eine Erzählung, Aufbau-Verlag 1983)
„Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra“ · Frankfurter Poetik-Vorlesungen; Luchterhand
1985 „Ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht · Gesprächsraum Romantik. Prosa. Essays“, zusammen mit Gerhard Wolf; Aufbau-Verlag
1986 „Die Dimension des Autors · Essays und Aufsätze, Reden und Gespräche 1959–1985“, 2 Bände; Aufbau-Verlag (Luchterhand 1987)
1987 „Störfall · Nachrichten eines Tages“; Aufbau-Verlag (Luchterhand 1987)
1988 „Ansprachen“; Luchterhand
1989 „Sommerstück“; Luchterhand
1990 „Was bleibt“ · Erzählung; Luchterhand (Aufbau-Verlag)
1996 „Medea. Stimmen“ · Roman; Luchterhand
1999 „Hierzulande Andernorts“ · Erzählungen und andere Texte 1994–1998; Luchterhand
2001 Abschluss der Werkausgabe (Band 12) bei Luchterhand
2002 „Leibhaftig. Erzählung“; Luchterhand
2003 „Ein Tag im Jahr. 1960–2000“; Luchterhand
2004 „Ja, unsere Kreise berühren sich. Briefe“; Luchterhand
2005 „Mit anderem Blick. Erzählungen“; Suhrkamp
2010 „Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud. Roman“; Suhrkamp
Preise (seit 1990)
1990 Premio Mondello für die italienische Ausgabe von „Sommerstück“; Ehrendoktorwürde der Universität Hildesheim und der Freien Universität Brüssel
1991 Honorary Member der American Academy and Institute of Arts and Letters
1993 Scholar des Getty Center for History of Art and the Humanities in Santa Monica, Kalifornien
1994 Rahel Varnhagen von Ense Medaille der Stadt Berlin; Aufnahme in die Akademie der Künste Berlin/Brandenburg
1999 Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis der Stadt Alzey; Samuel-Bohumil-Linde-Preis der Stadt Göttingen; Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund
2010 Uwe-Johnson-Preis
2010 Thomas Mann Preis


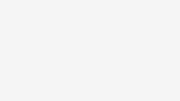





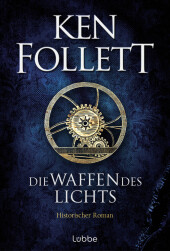
Kommentar hinterlassen zu "Ich habe die Arbeit gebraucht, um zu leben"