Auf der Cebit im März werden mehrere tausend Innovationen vorgestellt. Wann setzt sich eine neue technische Anwendung durch?
Wenn sie uns etwas bringt. Das muss nicht wirtschaftlich messbar sein, es kann auch einfach um den Spaß dabei gehen. Sobald eine technische Neuerung einen erkennbaren Mehrwert hat, spielt selbst eine schlechte Bedienbarkeit keine Rolle. Bestes Beispiel dafür ist die SMS, die es uns ermöglicht hat, kleine Textnachrichten hin und her zu schicken, und Menschen dadurch näher zusammenbringt. Am Anfang war es denkbar unbequem, auf den Handy-Tastaturen Texte einzugeben, und trotzdem hat sich die SMS durchgesetzt.
Haben Sie auch ein Beispiel für Produkte, die gerade wegen ihrer guten Bedienbarkeit erfolgreich sind?
Apple hat von vornherein sehr viel Wert auf Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit gelegt. Beide wurden früher als Sekundärtugend betrachtet. Apple hat es gerade damit geschafft, einen Gegenpunkt zu dem anfangs übermächtigen Mitbewerber Microsoft zu setzen. Heute wird Benutzerfreundlichkeit immer wichtiger, da die Systeme, die wir bedienen, immer komplexer werden. Umso entscheidender ist es, dass sie so strukturiert sind, dass wir sie auch verstehen.
Das ist ja nicht wirklich der Fall. Viele sind doch selbst von den Möglichkeiten ihres eigenen neuen Smartphones überfordert.
Die Geräte können heute sehr viel mehr als noch vor zehn Jahren. Daher sind sie schwieriger zu bedienen. Aber wenn ein Gerät, das zehnmal so viel kann, nur doppelt so schwierig zu bedienen ist, ist auch viel gewonnen.
Vielleicht können die Geräte zu viel?
Das ist teilweise dem Markt geschuldet. Zusätzliche Funktionen sind ein Verkaufsargument. Diese Entwicklung ist eine Sackgasse. Bislang gibt es leider noch keine Werbung, die sagt: Dieses Gerät kann das, was die anderen können, ist aber leichter zu bedienen. Die Technik darf kein Selbstzweck sein, sie soll den Menschen unterstützen. Nur weil etwas technisch möglich ist, ist es nicht unbedingt sinnvoll. Vielleicht müssen wir auch von der Wegwerfkultur loskommen. Ich selbst halte zum Beispiel aus Interesse alte Rechner am Laufen, der älteste ist von 2003. Das ist jenseits von dem, was wir heute als Lebensspanne für einen Rechner ansehen.
Warum hat sich die Touchscreen-Technologie durchgesetzt?
Touchscreen war ein Qualitätssprung. Ich kann mit meiner Hand auf einem Touchscreen mehr machen als auf einer Tastatur mit vierzehn Tasten. Auch die Programmierer sind flexibler in der Gestaltung. Außerdem steckt eine höhere Rechenleistung dahinter. Was heute die Handys leisten, das hätten wir uns in meiner Jugend nicht mal von einem Großrechner erträumt. Was früher gebäudefüllende Rechenanlagen waren, das tragen wir heute in der Hosentasche.
Ist das die Zukunft, dass wir immer mehr Technik mit uns herumtragen?
Die mobilen Geräte wie Tablet und Smartphone machen es völlig plausibel, keinen PC mehr zuhause zu haben. Die nächste Generation sind Geräte, die ich am Körper trage, wie digitale Uhren und Brillen. Ein Doktorand an meinem Lehrstuhl untersucht gerade, wie diese Geräte sozialverträglich und sinnvoll in den Alltag integriert werden können. Interessanterweise beschäftigen wir uns in unserer Forschung immer weniger mit der Entwicklung von Technik als vielmehr damit, wie damit umgegangen wird.
Und ändert sich da etwas?
Ich habe die Hoffnung, dass wir es irgendwann schaffen, die Technik der Computer nicht mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Heute ist für uns elektrisches Licht eine Selbstverständlichkeit, über die wir uns keine weiteren Gedanken machen. Wir müssen nicht wissen, wie man ein elektrisches Kabel verlegt, nur damit wir das Licht anschalten können. So weit sind wir in der Computertechnik noch lange nicht. Hier müssen Anwender noch viel mehr über Technik verstehen, die sie im Grunde nicht interessiert. Das ist nicht in Ordnung. Wir sollten Systeme bauen, die wir ohne technisches Hintergrundwissen bedienen können, und versuchen, das Mehr an Funktionen, vor dem wir uns heute nicht verschließen können, auf eine menschengerechte Art zu integrieren mit Blick auf denjenigen, der es bedienen wird. Wenn wir weniger Zeit für den Rechner selbst aufwenden müssen, haben wir viel mehr Zeit für unsere Arbeit, die wir damit tun wollen.
Ist es stattdessen ein allgemeiner Trend, dass uns die Technik immer mehr abverlangt?
Im Marktsegment Tablet, PC und Smartphone ist das sicherlich der Fall. Aber es gibt andere Bereiche, in denen schon länger die menschlichen Ressourcen berücksichtigt werden, etwa unsere Aufmerksamkeit und unser Gedächtnis. In der Automobilbranche gibt es viele Entwicklungen, bei denen die Technik ganz selbstverständlich in den Hintergrund tritt. Autos haben heute eine Funktionsvielfalt, die nicht in dieser Komplexität zu Tage tritt. Zum Beispiel steckt beim Adaptive Cruise Control (ACC), durch den das Auto automatisch Abstand zum Vordermann hält, sehr viel Technik dahinter. Als Fahrer bemerke ich aber nur, dass das Auto abbremst, wenn das Fahrzeug vor mir zu nahe kommt. Das Auto tut, was es soll, ohne dass ich mir Gedanken darüber machen muss, wie das genau funktioniert.
Warum ist gerade die Automobilbranche so weit?
Im Autokontext war man schon immer gezwungen, den Menschen nicht mit störendem Input zu belasten, damit er sich auf den Verkehr konzentrieren kann. Es gibt strenge Vorschriften, zum Beispiel, wie lange man den Blick von der Straße abwenden darf. Da kann man gar nicht so komplexe Systeme bauen, die dem Nutzer zu viel Aufmerksamkeit abverlangen. Wenn es solche Vorschriften auch für Handys gäbe, sähen die Geräte anders aus.
Technische Anwendungen werden heute global angeboten. Gibt es kulturelle Unterschiede bei der Vorstellung, was Technik können soll, und auch bei den Vorlieben der Anwender?
Bei unseren Handys stecken meist amerikanische Firmen wie Apple oder Google dahinter, daher sind sie in der äußeren Form von westlicher Ästhetik geprägt, die eher nüchtern und reduziert ist. Webseiten in Asien sehen beispielsweise völlig anders aus als bei uns. Sie sind wesentlich voller, für unseren Geschmack überladen, von einer gewissen barocken Ästhetik. Es mag durchaus sein, dass dieser Einfluss teilweise beim Design von Benutzerschnittstellen der Geräte mit ihrer überbordenden Funktionsvielfalt mitspielt, die ja meist im asiatischen Raum gefertigt werden.
Die Bedienflächen von Smartphones sehen zumindest sehr voll und bunt aus.
Die Apps, die von so vielen Menschen geschrieben werden, sorgen für einen gewissen Wildwuchs. Es gibt keine zentrale Kontrolle mehr. Wie im echten Leben ist die Vielfalt aber erst einmal gut. Ich bin doch deswegen nicht gezwungen, mir alles auch zu installieren, und ich bin frei zu löschen, was ich nicht brauche. Ich selbst habe zum Beispiel gerade mein altes Smartphone reparieren lassen. Es hat nicht das neueste Betriebssystem, kann aber alles, was ich brauche. Da habe ich bewusst reduziert.
Sie entwickeln an Ihrem Lehrstuhl neue Interaktionsmöglichkeiten, wie Nutzer technische Geräte bedienen können. Was ist das zum Beispiel?
Immer komplexere Technik birgt eine große Gefahr für die Privatsphäre. Wenn ich mir heute eine Webseite ansehe, weiß ich nicht, welche Informationen währenddessen über mich übermittelt werden. Ich sehe nur, dass mir am nächsten Tag dazu passende Werbung eingeblendet wird. Momentan habe ich nur die Alternative, das in Kauf zu nehmen, oder auf die Webseiten zu verzichten. Diese Situation eröffnet die Chance für neue Bedienkonzepte für mehr Sicherheit und Privatsphäre. Einer unserer Doktoranden forscht zum Beispiel gerade daran, dass ein Handy anhand der Toucheingabe – die von Person zu Person unterschiedlich ist – den Benutzer erkennt und sich dadurch entsperren lässt. Das ist immer eine Frage der Spielregeln: Stellt sich die Maschine auf den Menschen ein oder der Mensch auf die Maschine? Bei letzterem muss ich komplizierte Passwörter auswendig lernen. Wenn sich die Maschine aber auf uns Menschen einstellt, entlastet sie uns.
Professor Andreas Butz ist Lehrstuhlinhaber für Mensch-Maschine-Interaktion an der Lehr- und Forschungseinheit Medieninformatik der LMU.
Interview: Nicola Holzapfel










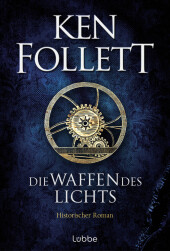
Kommentar hinterlassen zu "In Zukunft bitte einfach"