In den Redaktionen führt die ökonomische Krise zu einer personellen Erstarrung. Der Stillstand der Literaturkritik nimmt bedrohliche Formen an.
In den Jahren um die Jahrtausendwende erlebte die deutschsprachige Literaturkritik eine Blütezeit. Die Literaturbeilagen schwollen an, die „Süddeutsche Zeitung“ nahm eine täglich erscheinende Literaturseite ins Blatt, die „Literarische Welt“ erlebte eine Wiedergeburt, die Zeitschrift „Literaturen“ drang selbstbewusst auf den Markt. Viele Regionalzeitungen betrieben eine ambitionierte Literaturberichterstattung, ein Arsenal an freien Kritikern beackerte die Flut der Neuerscheinungen und war mit daran beteiligt, dass ein breites Spektrum der literarischen Produktion der Verlage vom Publikum wahrgenommen werden konnte. Die Zeiten haben sich geändert. Die ökonomische Krise der Zeitungen und Zeitschriften hat die Bedingungen und Strukturen der Literaturkritik nachhaltig verändert.
Der freie Kritiker verschwindet
Eine Folge dieser Strukturveränderung ist das weitgehende Verschwinden des freien Kritikers. Kulturredakteure wurden in den Krisenjahren nach 2002 häufig von ihren Verlegern mit der Anweisung konfrontiert, die Literaturberichterstattung in erster Linie mit dem redaktionellen Stammpersonal zu bewältigen. Die Honorare für freie Kritiker sanken in den Hobbykeller, bei der „NZZ“ beispielsweise innerhalb weniger Jahre auf ein Viertel der früheren Beträge. Die Regionalzeitungen haben die Literaturberichterstattung stark eingeschränkt oder gar eingestellt. Kaum eine Berufsgruppe musste in den letzten Jahren ähnliche finanzielle Einbußen verkraften wie die freien Journalisten und Kritiker. Zahlreiche talentierte Kritiker sind in den letzten Jahren vom Markt verschwunden, sie schreiben Reiseberichte, arbeiten in Verlagen, in Literatur- und Auktionshäusern.
In den Redaktionen führt die ökonomische Krise zu einer personellen Erstarrung. Die Protagonisten der Literaturkritik sind heute weitgehend dieselben wie vor zehn Jahren. Wer damals ein Pöstchen in einer Literaturredaktion hatte, hält sich bis heute daran fest. Das gilt für die Literaturredaktionen. Es mag graduelle Unterschiede geben – die „FAZ“ verjüngt sich beispielsweise aktiver als etwa die „NZZ“.
„Kann nur noch besprechen, was der Chefredakteur kennt“
Der personelle Stillstand ist Folge einer Verlagspolitik. Auch veränderte sich auf Wunsch der Zeitungsverleger der literaturkritische Blick auf die aktuelle Buchproduktion: Nicht dem literarisch ambitionierten Produkt, der verborgenen Kostbarkeit, dem subjektiv als Kunst erkannten Werk hatte das suchende Auge des Redakteurs zu gelten, sondern den Büchern, denen die breite Aufmerksamkeit zuzutrauen ist. „Ich kann nur noch besprechen, was der Chefredakteur kennt“, ist ein typischer Stoßseufzer.
Bei einer solchen Vorherrschaft des Volkswillens geht der Kern der Literaturkritik verloren: Die pure Subjektivität, die Unabhängigkeit des Kritikers, was die Auswahl des Gegenstands und auch sein Urteil darüber betrifft. Zunehmend verengt sich der literarische Horizont und es sind meist dieselben Titel, die durch den Blätterwald getrieben werden. Dass zahlreiche Literaturzeitschriften wie etwa „Volltext“, „sprachgebunden“, „bella triste“ und Kulturmagazine im Internet wie culturmag.de und getidan.de sich seit Beginn der Zeitungskrise als sichtbarer Bestandteil des kulturellen Diskurses etablieren konnten, mag auch mit den Lücken zu tun haben, die sich im Feuilleton aufgetan haben.
Redaktionen verlegen Bücher
Hinzu kommt, dass die Verlage selbst als Produzenten literarischer Werke in Erscheinung traten und dies mit stark merkantilem Drang. Ungeniert wurden die ausgewählten Werke den Redakteuren des Feuilletons vorgelegt, um diese mit tauglichen Werbetexten zu versehen. Die Hürden, die damals genommen wurden, fehlen heute. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass ein Literaturkritiker für sein eigenes literarisches Werk einem Nobelpreisträger ein Zitat zu einem eigenen Werk abfordert (das der Nobelpreisträger mangels Sprachkenntnissen kaum gelesen haben kann), um damit den Marktauftritt des Werkes zu verbessern. Hier wurden die merkantilen Ambitionen, die in die Redaktionen getragen wurden, konsequent weitergedacht.
Ein Symptom für das abnehmende Gewicht der Literaturkritik zeigt sich auch in den Tätigkeitsfeldern, denen sich Großkritiker inzwischen zuwenden. Thomas Steinfeld teilt sein Bedürfnis, als Autor in Erscheinung zu treten, mit zahlreichen Kollegen und Kolleginnen, die ebenfalls mit Fiktionalem und Non-Fiktionalem zu reüssieren gedenken. Der leitende Redakteur der „Süddeutschen“ legt in diesem Herbst allein drei Bücher vor und liegt damit sogar vor Roger Willemsen in der Kategorie „Anzahl Neuerscheinungen pro Halbjahr“. Neben dem Krimi „Der Sturm“ wird auch sein Buch über die „Zukunft des Reisens“ bei S. Fischer mit einem Zitat von Orhan Pamuk beworben: „Beim Reisen geht es nicht um Entfernungen, es geht um die Begegnung mit etwas anderem.“
Sehnsucht nach der „Begegnung mit etwas anderem“
Diese Sehnsucht nach der „Begegnung mit etwas anderem“ scheint ein wesentliches Motiv der feuilletonistischen Produktion der Gegenwart zu sein, die in der literarischen Produktion nur noch selten eine Auseinandersetzung mit der Welt auf Augenhöhe zu entdecken vermag. Thomas Steinfeld hat in den letzten Monaten beispielsweise über die Folgen der Erdbeben in Italien und der Türkei geschrieben. Wer möchte ihn da zu einer Rezension über Gegenwartsliteratur verdonnern? Längst wurde das thematische Spektrum des Feuilletons so erweitert, dass die ganze Schwere der Welt darin geborgen werden kann. Nichts ist dem Feuilleton mehr fremd. Statt ästhetische Fragestellungen zu erörtern, wird das Feuilleton zunehmend appellativ: Esst vegetarisch, denkt europäisch, meidet Bankangestellte.
Die Erstarrung des Personals zeigt sich auch in den Debatten, die der Literaturbetrieb noch zu führen in der Lage ist. Es sind meist die Provokationen der Kollegen, denen sie sich mehr oder weniger widmen. Debatten, die an der ästhetischen Substanz gegenwärtiger Produktionen rütteln und schütteln, erlebt man derzeit nicht.
Jury küren Bestseller
Die Flucht der Feuilletonisten aus der Literaturkritik hat viele Richtungen. Die „Zeit“ tut sich zunehmend schwer, in der Gegenwartsliteratur Titel zu finden, denen sie eine Rezension widmen möchte. Sieben Ausgaben hat die Wochenzeitung deshalb mit einem Kanon über die Literatur in Europa der letzten Jahrzehnte gefüllt. Der SPIEGEL hebt Hermann Hesse mit einem Autorenporträt auf die Titelseite, das nahezu identisch vor einigen Jahrzehnten dort zu finden war. Der nach oben gerichtete Mittelfinger stellt den Gegenwartsbezug her.
Die Literaturkritiker, die sich nicht als Autoren betätigen oder Hesse lesen, sind in der Regel in einer Jury anzutreffen. Dort werden inzwischen effizienter, als dies der Literaturteil zu bewerkstelligen vermag, die Bestseller gekürt. Durchaus wirksam wird dem Bedürfnis nach aktiver Literaturvermittlung auch bei einem der zahlreichen Literaturfestivals, als Gast im Literaturhaus in X, Genüge getan.
Man kennt sich bestens, weiß, wer den neuen Roman von Y loben wird und wer demnächst in welche Jury berufen wird. Man weiß, wer einem helfen kann, ein erfolgreicher Autor zu werden. Man weiß, wer im Frühsommer im Wolfgangsee schwimmen geht und mit wem man über Fußball reden kann. Man weiß, auf welche Provokationen die Kollegen noch reagieren. Der Zunft fehlt das Überraschende, das Unvorhersehbare. Wie einem See, dem die Zuflussadern abgeschnitten wurden, ist der Literaturkritik die Frische abhandengekommen. Es droht die kollektive Versumpfung.
Auf der Suche nach neuen Spielregeln
Sollte das Schreiben von Bestsellern sich in der Gemeinschaft der Autoren und Kritiker tatsächlich als tragendes Motiv des Schaffens durchsetzen und sich die verkauften Stückzahlen als wesentliches Kriterium bewähren, wäre zu überlegen, ob sich die Literaturkritik nicht adäquat zum Sport auf gewisse Regeln für den Auftritt im Wettbewerb einigt.
Vergleichbar zum Doping wäre womöglich die unlautere Platzierung eines falschen Zitates auf dem Produkt unter Strafe zu stellen und der Autor oder der Verlag, der dagegen verstößt, mit einem Publikationsverbot von einigen Monaten bis Jahren zu belegen. Ähnlich wäre mit Autoren zu verfahren, die ihr Produkt mit entsprechenden Lobeshymnen in Online-Buchshops zu befeuern versuchen. Wer sich am Jahresende in einem weitgehend fair ausgetragenen Bestsellerwettbewerb als Sieger im SPIEGEL sieht, darf zur besten Sendezeit dann mit Richard David Precht im ZDF philosophieren. Womöglich wäre Herr Precht dazu bereit, gegebenenfalls das Gespräch auch mit sich selbst zu führen.
Joachim Leser, Jahrgang 1966, leitete jeweils fünf Jahre die Pressestelle beim Ammann Verlag und bei Kein & Aber. Seit 2009 ist er bei Schulthess Juristische Medien in Zürich als Portalmanager und Online-Buchhändler tätig. Joachim Leser schreibt seit Oktober 2009 im buchreport-Blog.











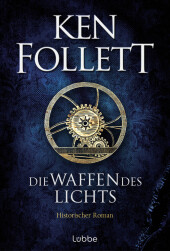
Die ‚Rudelbildung‘ trägt zum Verfall des Feuilleton bei: Heutzutage ist oft so, dass aus irgendwelchen Gründen sich alle auf dasselbe Häufchen Buchstaben stürzen – ich erinnere nur an den unsäglichen Hype um Helene Hegemann. Alle Feuilletonisten sitzen anbetend oder verdammend ums Gestammel herum, aber alle heulen den gleichen Mond an – sämtliche Zeitungen haben tagelang nur noch ein Thema. Statt dass es zur Arbeitsteilung käme – und zur Missachtung des schnappatmigen ‚Hypa-hypa-Hyperventilierens‘ …
Ein sehr schöner Beitrag, der knapp und dennoch ausführlich viele wichtigte Aspekte benennt und auch meinen nicht sonderlich originellen Eindruck auf den Punkt bringt, dass die Feuilletons überwiegend mit Selbstbespiegelung beschäftigt sind!
Was mir aber auch hier, wie generell im Feuilleton, zu kurz kommt, ist – der Leser. Wie so oft, wird auch in diesem Artikel die „ökonomische Krise der Zeitungen und Zeitschriften“ mit für den „Verfall“ der Kritik verantwortlich gemacht. Setzt eine Zeitung, die sparen muss, den Rotstift denn wirklich zuerst beim Feuilleton an, weil es dort so viel zu sparen gibt (so hoch werden die Honorare der freien Kritiker wohl nicht ausfallen)? Oder hängen die Sparmaßen bei den Feuilletons nicht vielmehr damit zusammen, dass die Leserschaft einfach nicht mehr groß genug ist und Zeitungen offenbar mit neugegründeten Ressorts und Sonderausgaben („Glauben“, „Wissen“, „Reisen“, „Ernährung“ und wie sie alle heißen) deutlich mehr Leser ansprechen?
Was ich wirklich gern mal sehen würde, sind Zahlen: Wie viele Leute lesen heute eigentlich noch Literaturkritiken in ZEIT, FAZ und Co.? Und wie viele dieser Leser lesen Literaturkritiken nicht nur, weil sie selbst mit dem Literaturbetrieb verbandelt sind?
Die Lage der Kritik gleicht der des Buchhandels: der
Mittelstand trocknet aus. Das Feuilleton sucht sein Heil in einem mühsam
getarnten Kulturboulevard, der aus dem sperrigsten Text noch irgendeinen Unterhaltungsaspekt
pressen muss. Ernsthafte literarische Reflexion verschwindet in die
Spezialzeitschriften und ins Internet.
Um es den Kritikern einfacher zu machen, präsentieren die Verlage
ihre Autoren als Unterhaltungs-Gesamtpaket, das sich mühelos den bereitstehenden
Formaten anzuschmiegen weiß, wozu je nach Charakter des Autors Erotik,
Gesellschaftskritik, Wilder Mann, Tabubrecher oder anderes in Frage kommen. Dem
passt sich die Literaturkritik umso leichter an, als sie in der Regel von
Journalisten betrieben wird, also von Agenten des Neuen. Das Neue ist
bekanntlich das Uralte von Morgen. Dennoch, und das ist das Erstaunliche, wird
das Bedeutende nach wie vor erkannt, gefördert, reflektiert, wenn auch in der
Regel mit einem gewissen mit Zeitverzug. Als Zeitungsleser hat man den
Eindruck, dass es eine Literaturkritik fürs Volk gibt, und dann die eigentliche
Meinung der Experten, die dazu führt, dass etwa ein Wolfgang Hilbig oder ein W.
G. Sebald nicht vergessen werden.
Das war aber früher nicht anders. Nicht die Krisenzeiten,
sondern die ökonomischen Boomzeiten erzeugen einen falschen Eindruck von „der
Literatur“: Die Vielen glauben, es gäbe so unendlich viel davon, dabei ist die
Zahl bedeutender Künstler in jeder Generation überschaubar, unabhängig von der
ökonomischen Lage des Betriebs. Um das zu verstehen, muss man sich ein Leben
lang mit schwierigen Texten beschäftigen, aber wer will das schon? Gebraucht
werden die bunten Abziehbilder, wozu manche Autoren ihr Teil beitragen, indem
sie als Reservegoethe, Götterliebling, Avantgardistendarsteller oder Gesellschaftskritikerin
posieren.
Literatur ist nicht das einzige Feld, in dem solche Entwicklungen zu beobachten sind. Spielregeln werden auch dann nicht helfen, wenn sie nicht ganz ernst gemeint sind. Disruptives Nutzerverhalten ist angesagt.
Eine kluge Analyse, doch was hilft’s gegen ein marodes System? Ich bin selbst eine dieser Feuilletonistinnen und Kritikerinnen, die aufgrund einer der letzten Medienkrisen das Handtuch geworfen haben und das Geld nun lieber andersweitig verdienen. Und trotzdem hin und wieder bloggend rezensieren – ganz nach eigenem Gusto.
Von daher würde ich den Fokus in Sachen Zukunft gern auf neue Formen lenken, die sich längst entwickeln, aber nicht richtig gefördert werden. Was wir brauchen, ist nicht die Rückkehr des guten alten Feuilletons, sondern eine moderne, zeitgemäße Alternative – gern auch mit völlig neuen medialen Ansätzen. Bisher hakt es da an drei Faktoren: Medialer Aufmerksamkeit (die natürlich die Etablierten gern verhindern), neuen Finanzierungsformen und vor allem: einer gediegenen Ausbildung und Förderung von Kritikertalenten, auch berufsfremden.
Dazu müssten aber auch und vor allem die Presseabteilungen der Verlage und die Buchhändler umlernen, die allzu oft so reagieren, als könnten nur die Bücher taugen, die den Segen des „großen (gedruckten) Feuilletons“ bekommen. Vor allem aber gebt den freien Kritikern genug zu Essen, dann müssen sie beim Schreiben auch nicht mehr ihre Seele verkaufen.
Ob Kritik oder nicht, es würde sich nicht viel in Deutschland ändern. Die politische Verbissenenheit kritischen Zerpflückens scheint Echtes zu überlagern. Trotzdem ist dieser Verfall höchst zu bedauern für das Häuflein „Unverbesserlicher“.