Das Teilen und Remixen von Lernmaterialien ist hierzulande schwierig, weil Lehrer Abmahnungen fürchten müssen. Anderswo setzen Schulen und Unis auf offene Lizenzen.
„Würdest du mir deine Unterlagen geben?“ Egal ob an Universitäten oder an Schulen, diese Frage ist für Lehrkräfte völlig selbstverständlich. Wer eine neue Stelle antritt, erkundigt sich bei Vorgängern und Kolleginnen nach dem Lernmaterial, das bislang verwendet wurde. Nicht, um es unverändert zu übernehmen, sondern um es umzugestalten, zu ergänzen und neu zu ordnen. Wenn es um Lehr- und Lernunterlagen geht, gehört Remix schon lange zum Alltag, herrscht eine Kultur des Teilens. Allerdings endet sie auch in Zeiten von Internet und digitaler Kopie immer noch an den Mauern der jeweiligen Hochschule beziehungsweise an der Tür des Lehrerzimmers.
Die Gründe für die Zurückhaltung beim digitalen Teilen von Lernunterlagen sind vielfältig. Manche fürchten den kritischen Blick von Kollegen, weil sie nicht sicher sind, ob ihre Folien und Arbeitsblätter im wahrsten Sinne des Wortes vorzeigbar sind. Andere scheuen den Mehraufwand, Dinge im Netz zur Verfügung zu stellen. Ganz oben auf der Liste der Gründe steht aber das Urheberrecht. Was in Klassenzimmern, Hörsälen oder auch auf geschlossenen Onlinelernplattformen wie Moodle passiert, bekommt außer den Kursteilnehmern niemand mit. Sobald Unterlagen aber frei online gestellt werden sollen, siegt die Angst vor der Abmahnung über die Bereitschaft, Wissen zu teilen.
Im Ergebnis ist es also so, dass öffentlich bezahlte Lehrkräfte zwar täglich und immer wieder von Neuem Lernmaterial produzieren und dieses auch durchaus bereitwillig mit Kollegen teilen. Die Möglichkeiten zum digitalen Austausch bleiben jedoch ungenutzt. Mehr noch, nahezu alle öffentlich oder über Elternbeiträge finanzierten Schul- und Lehrbücher sind im Internet schwer auffindbar oder nur in streng kopiergeschützten Dateiformaten verfügbar, die eine Anpassung an individuelle Bedürfnisse vereiteln – von Rekombination mit anderen Materialen und deren Weitergabe ganz zu schweigen.
Britische Unis geben sich selbst neue Richtlinien
Im angelsächsischen Raum wollen sich Bildungseinrichtungen und Bildungspolitik mit dieser unbefriedigenden Situation nicht länger abfinden. In Großbritannien wächst die Zahl der Universitäten, die sich selbst Richtlinien für offeneren Zugang zu Lernunterlagen verordnen. Beispielsweise hat die Universität Edinburgh kürzlich eine Open Education Policy veröffentlicht.
Darin werden die Mitarbeiter der Universität explizit dazu ermuntert, Lernunterlagen aller Art – von Lehrbüchern über Arbeitsblätter und Folien bis hin zu Lernvideos – in offenen Formaten und unter offenen Urheberrechtslizenzen im Netz zu teilen. Konkret empfiehlt die Richtlinie die Nutzung einer sehr liberalen Creative-Commons-Lizenz, die der Allgemeinheit umfassende Nutzungsmöglichkeiten einräumt, solange auf den Namen des Autors der Unterlagen verwiesen wird. Nach Möglichkeit sollen derart offene Lernunterlagen – Open Educational Resources, OER – in ein zentrales Multimedia-Archiv der Universität eingestellt und so dauerhaft verfügbar gehalten werden.
Als Begründung für diese Empfehlung verweist die Richtlinie darauf, dass die Nutzung, Erstellung und Verbreitung offener Lernunterlagen im Einklang mit der Reputation, den Werten und der Mission der Universität stehen, nämlich „substanzielle, nachhaltige und sozial verantwortungsvolle Beiträge“ zum Allgemeinwohl zu leisten. Die Universität Edinburgh steht mit ihrer Richtlinie keineswegs alleine da, sondern in einer Reihe mit weiteren Universitäten in Leeds, Glasgow und Greenwich.
Die Bewegung für eine derart digitale Lernmittelfreiheit beschränkt sich nicht auf den Universitätsbereich. In den USA setzen bereits ganze Schulbezirke – etwa der in Williamsfield im Bundesstaat Illinois – auf offen lizenziertes Lehrmaterial, das frei weiterverbreitet, adaptiert und miteinander kombiniert werden kann. Ganz allgemein ist die Nutzung offener Lizenzen in den USA inzwischen der Standard, wenn öffentliches Geld oder Mittel gemeinnütziger Stiftungen in die Erstellung von Lernunterlagen fließen.
Die Politik vertraut lieber dem freien Markt
Das Beispiel Williamsfield zeigt, woran es in Deutschland noch fehlt: an einer Reform der öffentlichen Finanzierung von Lernunterlagen, damit öffentliche Mittel nicht nur in die Anschaffung von Büchern, sondern auch in die Erstellung von digital-offenen Lernmittel fließen können. In einem Bericht der gemeinsamen Arbeitsgruppe von Bundesforschungsministerium (BMBF) und Kultusministerkonferenz (KMK) zum Thema werden zwar die Potenziale von OER betont. Wenn es um ein klares politisches Bekenntnis zu deren Förderung geht, gibt man sich aber zurückhaltend: „Die Dynamik des Marktes und damit verbunden mögliche neue Angebotsformen von [offenen Lernmitteln] werden entscheiden, welche Geschäftsmodelle sich durchsetzen können. Die öffentliche Hand hat dabei strikte Neutralität zu wahren.“
Mit anderen Worten. Es wird erwartet, dass der Markt über neue Lernmittelplattformen wie meinUnterricht.de oder Tutory.de von selbst die besten Lösungen hervorbringt, solange sich die Politik nicht zu sehr einmischt oder gar auf eine Seite schlägt.
Von Neutralität kann keine Rede sein
Tatsächlich ist es jedoch so, dass sich die öffentliche Hand in Deutschland derzeit eben nicht neutral verhält. Die bestehenden Finanzierungsstrukturen für öffentlich finanzierte Lernmittel im Schul- und wie im Universitätsbereich sind ganz auf die Anschaffung gedruckter und urheberrechtlich umfassend geschützter Bücher ausgerichtet. An Schulen wählen beispielsweise Fachkollegien aus Schulbuchkatalogen ihre bevorzugten Bücher aus. Selbst wenn Lehrer das Geld lieber für offen lizenzierte Lernunterlagen ausgeben würden, fehlt es derzeit an den gesetzlichen Voraussetzungen dafür.
Eine gemeinschaftliche Finanzierung von offenen Lernmitteln ist in so einem Rahmen weder vorgesehen noch rechtlich möglich. Ohne Öffnung dieser Finanzierungsstrukturen für offen lizenzierte Lernmittel gibt es kaum eine Chance, dass sich OER im Mainstream der Bildungslandschaft etablieren. Um zumindest Neutralität herzustellen, sind große Anstrengungen von Seiten der Bildungsministerien der Länder zu unternehmen – ganz unabhängig von der Frage, ob Neutralität bei einer derartigen Richtungsentscheidung überhaupt wünschenswert ist oder ob nicht vielmehr öffentlich finanzierte Materialien ganz generell auch offen zugänglich sein sollten.
Denn je mehr Material offen lizenziert im Netz verfügbar ist, desto einfacher und risikoloser ist es dann auch für Lehrkräfte, darauf aufbauend eigene Materialien zu erstellen und diese wieder mit Kollegen zu teilen. Und zwar nicht nur hinter den schützenden Mauern von Klassenzimmern und Hörsälen, sondern im Internet. In einer solchen Kultur des digitalen Teilens steckt letztlich ein viel größeres Potenzial für bessere und offenere Bildung, als in den viel zitierten Laptop- oder Tablet-Klassen, die sonst immer zum Thema digitale Bildung bemüht werden.
LEONHARD DOBUSCH
Leonhard Dobusch ist studierter Jurist und Betriebswirt und als Professor für Betriebswirtschaftslehre am Institut für Organisation und Lernen der Universität Innsbruck tätig. Daneben bloggt er regelmäßig auf netzpolitik.org und twittert unter @leonidobusch.
Der Beitrag ist zuerst erschienen auf zeit.de.










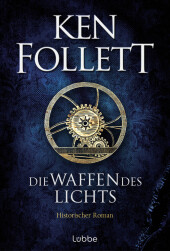
Die Probleme und Möglichkeiten sind seit längerem bekannt, und man fragt sich, warum sich nichts tut. Liegt es daran, dass Bildungspolitik eine der letzten Bastionen des Föderalismus ist? Sind die Befindlichkeiten der Kultusminister wichtiger als das Ziel bessere Bildung? Wird da mit den Verlagen gemauschelt?
Die Problemlage ist freilich auf verschiedenen Ebenen unterschiedlich. Unerklärlich etwa, warum man in der Schulmathematik nicht seit vielen Jahren ein Einheitslehrbuch hat, das kontinuierlich verbessert wird.
In den Naturwissenschaften an den Unis hingegen entfaltet sich durch die russischen Piraten gerade eine Macht des Faktischen, der Verlage wie z.B. Elsevier oder Springer wohl nichts entgegen zu setzen haben, als ihre Geschäftsmodelle rapide auf Open Access umzustellen. Da werden die Kosten dann bei den Autoren hängen bleiben bzw. bei der öffentlichen Hand – halt in anderer Weise als bisher.