Wie verändert sich der Literaturbetrieb unter dem Einfluss der Digitalisierung? Dieser Frage hat sich die Konferenz Litfutur der Universität Hildesheim am Wochenende gewidmet. Im Interview beschreiben drei Macher der Tagung Eindrücke und Ausblicke auf eine Zukunft, in der „Gefräßigkeit und Besitzstand“ von „Geben und Teilen“ abgelöst werden könnte.
Zu den Diskutanten in Hildesheim gehörten u.a. Kathrin Passig (Journalistin und Schriftstellerin, Bachmann-Preisträgerin), der designierte Hanser-Verleger Jo Lendle, die PR-Beraterin Gesine von Prittwitz, Karla Paul (lovelybooks.de), Hauke Hückstädt (Leiter des Literaturhauses Frankfurt), Autor und Blogger Sascha Lobo (Foto: Mitte) und die Verlegerin Daniela Seel.

Organisiert wurde die Konferenz von 30 Studierenden der Universität Hildesheim, die sich mit Kreativem Schreiben, Kulturjournalismus und Kulturwissenschaften beschäftigen. Das Interview führte Daniel Lenz mit Guido Graf, Dozent am Institut für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft, und den Studenten Jacob Teich und Victor Kümel.
Anachronistische Strukturen in der Literaturbranche sind schlimm genug. Noch schlimmer wäre es, wenn es keine guten Ideen für die Modernisierung gäbe. Haben Sie bei Litfutur interessante Perspektiven gesehen?
Guido Graf: Ideen gibt es, denke ich, mehr als genug. Allerdings glaube ich nicht, dass sich die Lage auf einfache Dichotomien wie Alt vs. Neu reduzieren lässt oder dass es überhaupt eine Alternative zu Anachronismen gibt. Das wäre ja tatsächlich nur eine Frage der Perspektive. Der Musiksoziologe Johannes Ismaiel-Wendt hat bei Litfutur mit seiner Soundlecture „Ain’t no new thing“ zum Beispiel deutlich gemacht, was für ein zerstörerisches, invasives Potenzial in dem Konzept des „Neuen“ steckt, in der Rhetorik des nächsten großen Dings etc. Stattdessen plädiert er dafür, Innovation und Invention weniger als Marktstrategien denn erst einmal als ästhetische Praxis zu verstehen. Angewendet etwa auf den Buchmarkt kann das bedeuten, dass Open-Source-Konzepte und Community-Strategien, die nicht Teil eines Brandings sind, sondern quasi „von unten“ ausgehen, in der Lage sein könnten, solcher ästhetischen Praxis eine marktrelevante Gestalt zu geben.
Was Sie beschreiben, verstehe ich als Disruption – und das ist nicht nur ein ästhetischer Prozess, sondern extrem marktrelevant, weil Akteure, die sich nicht anpassen, verschwinden.
Guido Graf: Klar ist das für den Markt relevant, doch haben wir bei Litfutur z.B. auch darauf geschaut, was die ästhetische Praxis dazu sagt. Man muss das nicht gegeneinander ausspielen (so wenig Anlass die größeren unter den Marktteilnehmern auch haben, darauf acht zu geben), sondern kann ja auch nach Modellen suchen. Für Autoren, Zeitschriften und kleine Verlage etwa geht es in der Auseinandersetzung mit diesen Disruptionen um anderes. Daniela Seel, Verlegerin von Kookbooks, hat ihre Arbeit und die ihrer Mitstreiter denn auch nicht als Verlagstätigkeit im üblichen Sinne bezeichnet, sondern als Selbstverteidigung. „Poesie als Lebensform“ – das ist hier durchaus ernst gemeint.
Victor Kümel: Aber wäre Anpassung nicht dasselbe, wie zu verschwinden? Auch vorauseilender Gehorsam einem wie auch immer gearteten imaginierten Fluchtpunkt entgegen kann ja kein Rezept sein. Die Wichtigkeit der Position des traditionellen Gatekeepers steht für mich außer Frage. Was ich fragwürdig finde, ist die Selbststilisierung als altehrwürdigen Kapitän, der notfalls lieber erhobenen Hauptes mit seinem Schiff untergeht, als sich umzusehen. So wichtig diese Werte und Positionen sind, so wichtig ist es, sie als Teil des Gesprächs zu verstehen, andere Standpunkte wahrzunehmen und anzuerkennen, nach Synthesen zu suchen, schon auf rein begrifflicher Ebene.
Jacob Teich: Viel entscheidender als komplette Anpassung – denn das wäre ja irgendwie auch langweilig – scheint mir ebenfalls zu sein, dass neue Akteure und Methoden integriert werden. Also dass diejenigen, die – aus welchen Gründen oder Ängsten heraus auch immer – nicht bereit sind sich anzupassen, dennoch das Potenzial anerkennen, das durch einen neuen Umgang, eine ästhetische Praxis hervorgerufen wird. Und vielleicht ändert sich dann auch deren Betrachtungsweise, und sie sind bereit, den nächsten Schritt zu gehen, weil sie bemerkt haben, dass es auch anders funktionieren kann. Dass das, was vielleicht als Bedrohung wahrgenommen wurde, eben auch Chancen und Möglichkeiten für Neues in sich birgt. Es wird am Ende ja auch nicht das eine Modell geben, das sich gegenüber allen anderen durchsetzt. Aber in der Diversität liegt doch ein enorm hoher Reiz für das, was da noch kommen wird.
Guido Graf, Sie schreiben im Perlentaucher: „Der Kitt, der das Familienbild des Literaturbetriebs mal zusammengehalten hat, ist mürbe geworden oder schon ganz aus den Fugen gefallen.“ Wo sehen Sie die größten Erosions-Stellen aktuell?
Guido Graf: Was erodiert, sind ja die Rollenzuschreibungen und Rollenverteilungen, die damit einhergehenden Kommunikations- und Publikationsprozesse sowie die Lebensentwürfe der am Betrieb Beteiligten. Manche fegt es einfach weg, andere lernen dazu, wieder andere schaffen es, ihre Existenz für eine gute Weile zu sichern, usw. Das Bild der Erosion ist aber auch nur bedingt geeignet, die Vorgänge zu beschreiben, da ja damit so getan wird, als würde es sich um einen quasi natürlichen Prozess handeln oder um ein Ursache-Wirkung-Verhältnis. Was es so simpel ja nicht ist.
Jacob Teich: Man kann vielleicht nicht mehr so einfach sagen, ein Verleger/ein Autor macht genau das. Aufgabengebiete verändern sich, Kompetenzen werden andere, man wird damit konfrontiert, dass klassische Bilder nicht mehr greifen. Ein Autor ist doch schon jetzt Schreibender, Lesender oder Performender, PR-Beauftragter usw. Er kann ein Kurator sein, ein Vermittler, warum nicht auch Verleger? Vielleicht gilt es nur, die Flexibilität, die sich insbesondere durch die digitalen Möglichkeiten geboten hat, zu akzeptieren: Ja, es gibt im Netz Plattformen, die die Aufgaben des Feuilletons (viel besser) erfüllen. Ja, ich brauche nicht mehr zwingend einen Verlag, um mein Buch zu veröffentlichen. Ja, ich brauche nicht einmal mehr ein Buch, um Literatur zu veröffentlichen. – Aber all das wird eher als Gefahr wahrgenommen, als dass man diese Bereiche in sein Schaffen integriert und dem Diskurs angliedert.
Victor Kümel: Ich sehe den Bruch weniger zwischen einzelnen Akteuren des Betriebs, sondern viel grundsätzlicher zwischen digitaler und Buchkultur. Unmittelbar vor dem Abschluss meines Studiums ist das für mich, jenseits von ökonomischen Überlegungen, auch eine Sinnkrise. Was ich zunehmend vermisse, ist die Thematisierung dieser Konflikte und Widersprüche in der Literatur selbst. Ihr Platz in der digitalen Kultur kann ihr nicht von PR-Beratern zugewiesen werden. Er muss von Autoren gestaltet, formuliert werden.
Wie Facebook oder Amazon die Buch-Welt verändern, dazu ist zumindest hierzulande tatsächlich wenig von Autoren-Seite zu lesen, sowohl auf literarischer als auch Diskurs-Ebene. Ist das mangelndes Interesse?
Guido Graf: Das ist vermutlich so wie mit den jungen Fischen bei David Foster Wallace („This is Water“), die nicht wissen, was Wasser ist. Das Schreiben und Lesen findet in Umgebungen statt, die nicht oder kaum oder nur eingeschränkt als solche beobachtet werden. Das kann aber auch nur für eine Gruppe gelten. Eine andere Gruppe wäre die, die aus Prinzip nicht schwimmt, es auch nie gelernt hat. Und ganz selten ist die Spezies, die ihren Aggregatzustand verändern kann, die ihr Involviertsein in die Sozialen Medien und ihre Vertrautheit mit der Nutzung von Amazon als Retailer nicht hindert, Alternativen zu probieren, dieses Verhalten z.B. mittels ästhetischer Praxis zu reflektieren.
Victor Kümel: Ich glaube, es mangelt nicht an Interesse sondern an Anschlussmöglichkeiten ans literarische Feld. Es herrscht ein Protektionismus, der so weit geht, die Nennung von Amazon in einem Kinderbuch zu sanktionieren. Dieses Klima erschwert es der nachwachsenden Generation, ihre Aktivitäten im Netz als Bestandteil ihrer künstlerischen Praxis produktiv zu machen. Für die meisten AutorInnen hat das eine wenig mit dem anderen zu tun. Ich sehe hier auch die Literaturförderung in der Pflicht, Rahmenbedingungen für diese Formen zu schaffen, die der Markt (noch) nicht bietet. Jede zweite Kleinstadt leistet sich einen Literaturwettbewerb mit eigenwilligen regionalen Themenvorgaben. Es werden unzählige Anthologien zu Förderungszwecken gedruckt, die buchstäblich kein Mensch liest. Das ist unbefriedigend, vor allem für die jungen AutorInnen selbst, für die der Selbstzweck einer gedruckten Publikation immer fragwürdiger wird. Schon wenn man diesen Lokalpatriotimus ins Netz umlenken würde, im Sinne einer ganz basalen Grundversorgung, wäre viel gewonnen. Warum es so wenige Institutionen gibt, die sich darüber profilieren wollen, ist mir rätselhaft.
Jacob Teich: Wenn man überlegt, wie in der Literaturwissenschaft mitunter jede Notiz eines Autors/einer Autorin unter die Lupe genommen und in einem Zusammenhang zu seinem/ihrem Werk gebracht wird, mag es ja zunächst auch eigenartig wirken, dass die nächsten Generationen E-Mails, Facebook-Kommentare und Twitternachrichten gleichermaßen einbeziehen müssten. Vielleicht hemmt dieser absurd wirkende Gedanke also mitunter einen solchen Diskurs. – Ich glaube aber nicht, dass das auf mangelndes Interesse zurückzuführen ist. Es könnte ja auch wahnsinnig spannend sein, zu beobachten, wie sich Form und Inhalte ändern, wenn man all jene Kanäle einer eigenen Poetik unterwirft, also wie sich so etwas wieder rückwirkend auf das literarische Schaffen auswirkt und wie beide Formen vielleicht irgendwann miteinander verschmelzen. Vielleicht erzählen wir dann Geschichten auf einmal ganz anders. – Das lässt sich schwer sagen, aber auf einen Versuch sollten wir es doch alle ankommen lassen.
Sie singen im Perlentaucher ein Loblied der „Vergemeinschaftung“. Wie kann diese bei der Entstehung von Büchern und anderen Institutionen des Literaturbetriebs funktionieren?
Guido Graf: In dem Text für den Perlentaucher habe ich ja das Beispiel Quirky angeführt. Das ebenso wie Crowdfunding oder eine auf Korrektorats-, Lektorats- und auch Übersetzungsaufgaben Anwendung des Guttenplag-Prinzips könnte neue Möglichkeiten eröffnen. Und natürlich darf man sich im Klaren darüber sein, dass solche Instrumente auch neue Diskurse bewirken. Die Diskussion dessen, was wir heute gewohnt sind, literarische Qualität zu nennen oder Relevanz etc., basiert ja auch auf Übereinkünften, die anderen Hierarchien entstammen, denen etwa Originalität und Genialität als Konzepte erscheinen, die es zu verteidigen und durchzusetzen gilt.
Victor Kümel: Beispiele für kollaboratives Arbeiten, auch an Büchern, gibt es ja viele. Das Modell einer Community als Verlag geht darüber hinaus, weil die Community gleichzeitig ihre eigene Leserschaft ist. Es gibt in diesem Modell keinen Unterschied zwischen Autoren und Lesern, es gibt kein abgeschlossenes Produkt, weil es kein „Außen” gibt. Man ist dabei oder nicht, das ist alles. Deswegen ist auch die Frage nach der Qualität solcher im „Schwarm“ produzierter Texte aus der Perspektive eines Gatekeepers genauso berechtigt wie inkompatibel mit dem, was da vorgeht. Die Qualität des Textes lässt sich nicht an einem Produkt bemessen, sondern nur an der Erfahrung der Teilhabe. Daniela Seel hat in einer Gesprächsrunde bei Literatur Futur festgehalten es gäbe keine Krise der Produktion sondern eine Krise der Rezeption. Ich finde das Szenario des Verlags als Community deshalb so interessant, weil es einen möglichen Weg aus dieser Krise aufzeigt, auch wenn sich das noch sehr unwegsam anfühlt.
Jacob Teich: Was Dirk von Gehlen mit „Eine neue Version ist verfügbar” probiert, greift in unser Verständnis von Urheberschaft und einen gegenwärtigen Werksbegriff ein – es erscheint uns zunächst unmöglich. Gleichzeitig macht die Wikipedia doch deutlich, dass ein solcher Prozess sehr wohl funktionieren kann. In einer Gesprächsrunde bei Litfutur hat Sascha Lobo ebenfalls erklärt, dass er Sachbücher so schreibe: in einem Dokument, das Co-Autoren/Co-Autorinnen gleichermaßen bearbeiten können und auf das später auch Lektoren/Lektorinnen Zugriff haben. Wobei allen offensichtlich eine grundsätzlich positive Beurteilung von Kollaborationen gemein ist.
Die „Vergemeinschaftung“ ist also längst nichts Neues mehr. Auch wenn man an die Buchkultur denkt, so wird doch am Werk „Buch” längst kollaborativ gearbeitet: Der Autor/die Autorin wird in seinem Schreiben durch einen Lektor/eine Lektorin begleitet, es gibt ein Korrektorat, Grafikdesigner_innen, die sich um ein entsprechendes Cover kümmern usw. Nur dass ich noch kein Buch gesehen habe, in welchem im Impressum der Lektor aufgeführt worden wäre. Da hält man also ganz stark am klassischen Autorenbild fest. Dirk von Gehlen geht im Prinzip nur zwei kleine Schritte weiter: Er macht die Zusammenarbeit transparent und nutzt das Potenzial vieler. Damit macht er den Prozess erfahrbar (was evtl. sogar Literatur viel stärker erfahrbar macht, als es bisher nur im Lesen geschieht) und bietet gleichzeitig eine neue ökonomische Strategie. – Teilhabe, Partizipation und kollaboratives Arbeiten lassen sich also schon jetzt in bestimmten Bereichen antreffen, könnten aber in Zukunft eine größere Rolle spielen, wenn wir uns darauf einlassen.
In den Verlagen scheint der Verlust der Gatekeeper-Funktion inzwischen angekommen zu sein – die Dienstleistungsorientierung nimmt zu. Sehen Sie diesen Wandel auch in den Feuilletons und Preis-Jurys?
Guido Graf: Nein. Es gibt in den Feuilletons dafür natürlich Aufmerksamkeit. In den Printmedien und in den zugehörigen Onlineportalen sicher am meisten. Allerdings verstehe ich nicht so ganz die Unterscheidung zwischen Gatekeeper und Dienstleistung an dieser Stelle: wäre die Funktion des Gatekeepers keine Dienstleistung? Also – nur weil sie sich selbst nicht so versteht? Jeder gute Autor im Feuilleton eines Printmediums oder auch im Online-Angebot des zuständigen Zeitungsverlags wird seine Unverwechselbarkeit als Autor behaupten wollen und dennoch nicht eine Sekunde zögern, das jedem, der fragt, als Dienstleitung zu verkaufen. Es gibt Ausnahmen (z.B. Springer). Und die sind ja nicht unbedingt erfolgreicher – weder mit der Autorschaft noch mit der Dienstleistungskomponente. Die Sehnsucht nach dem Gatekeeper ist bei vielen sicher ungebrochen. Diejenigen, die das gar nicht interessiert, gehören aber auch nicht zum Zielpublikum der Dienstleistung. Die preiskrönenden Jury-Schafe legen sich gerne einen Wolfspelz an, zumindest untereinander. Das sorgt auch beim Buchpreis mittlerweile nicht mehr für merkliche Orientierungseffekte.
Was tun?
Guido Graf: Es ist wichtig, andere Perspektiven neben der Gatekeeper-Funktion kennenzulernen. Da ging (und geht es bisweilen ja noch) es immer darum zu regeln, was oder wer zugelassen wird oder was oder wer draußen bleiben muss. Die Kriterien dafür waren mehr oder weniger willkürlich, manchmal kenntlich gemacht, oft vollkommen intransparent. Die Alternative dazu ist nicht der bloße Verzicht auf irgendwelche Schranken. Die Alternative zur Literaturkritik, zur Autorität, die sich durch inhaltliche Kompetenz legitimiert, ist nicht keine Literaturkritik oder Inkompetenz. Vielmehr kann hier eine Perspektive eine neue Bedeutung gewinnen, die nicht mehr auf Gefräßigkeit und Besitzstand setzt, auf Vereinnahmung (und Ausschließung), sondern aufs Geben und Teilen. Relevanz heißt das entscheidende Kriterium und relevant ist allein, was geteilt wird. Dafür kann man Instrumente entwickeln, Plattformen, Umgebungen, auf, mit und in denen geteilt wird.
Hat sich das Konzept von Litfutur bewährt?
Guido Graf: Es hat sich gelohnt, sehr gelohnt, denn diese Veranstaltung, ihre Konzeption, Organisation und Produktion durch eine Gruppe von 30 Studierenden hat deutlich gezeigt, wozu eine motivierte (weil selbstbestimmte) Community in der Lage ist. Denn die Veranstaltung ist ja nur ein Teil dieses Prozesses, der jetzt weitergeht. Das hat man heute (27.5.) schon klar gesehen, als die erste Nachbereitung unmittelbar in Überlegungen mündete, wie wir anders, mit anderen neuen Formen weiter machen können. Und: wie wichtig allen die Frage nach Formen der Vermittlung ist, weil die großen Fragen nach DER Zukunft DER Literatur alle Antworten, die tatsächlich weiterführen, indem sie in Praxis münden, nur zustellen. Deshalb werden wir jetzt beispielsweise den Rest des Sommersemesters das Litfutur begleitende Projektseminar als (interne) „Unkonferenz” weiterführen: um die Veranstaltung zu evaluieren, aber auch um die aufgeworfenen Fragen zu diskutieren und um vielleicht zu neuen Konzepten zu kommen für ähnliche (aber natürlich ganz anders geartete) Veranstaltungen in den kommenden Jahren. So wurde etwa sehr rasch klar, dass die Form der Podiumsdiskussion künftig unter Androhung schlimmster Qualen verboten gehört. (Wolfgang Tischer hat das in seinem Bericht auch – nett, aber auch etwas herablassend: sind ja nur Studenten – beschrieben). Da sind wir zum Beispiel in der Umsetzung hinter unser eigenes, längst schon woanders suchendes Interesse zurück gefallen. Das heißt für Kommendes: kleiner, enger, schneller, flacher, irritierender, schwieriger, anstrengender, ausgelassener, übender, offener.
Jacob Teich: Ich glaube, wichtig war vor allem, dass mit Litfutur ein Raum geboten wurde, in dem Akteure verschiedener Branchen des Literaturbetriebs aufeinander getroffen sind und ihre Wahrnehmungen und Interessen verhandeln konnten. Eine Plattform zu bieten, auf deren Grundlage diskutiert wird, wie Literatur in Zukunft entstehen und insbesondere vermittelt werden kann, war ja auch erklärtes Ziel von Litfutur.
Selbst wenn diese Gespräche und Diskussionen nicht zwangsläufig in konkrete Projekte münden, ist dieser Austausch immens wichtig: Denn wer die verschiedenen Perspektiven kennt und bereit ist, den Wandel kreativ nutzbar zu machen – also nicht auf altbewährte Strukturen verweist -, wird wohl am ehesten Vermittlungsangebote oder Rezeptionsweisen entwickeln können, die am Ende gewinnbringend für alle Beteiligten sind – und für die Literatur die besten Anschlüsse an das bieten, was im Augenblick passiert.
Gleichzeitig hat man bei der Konzeption und Umsetzung erfahren können, wie aussichtsreich kollaboratives Arbeiten sein kann: Eine Idee gemeinsam umzusetzen, bietet enormes Potenzial, verschiedene Interessen zu berücksichtigen und auszuloten, wodurch nicht nur der Diskurs mannigfaltiger wird, sondern eben auch die Anschlussmöglichkeiten potenziert werden. Vermittlung ist dann kein vom Werk losgelöster Prozess mehr, sondern etwas, das von Anfang Teilhabe und Mitbestimmung gewährt – und somit die Akteure zusammenbringt.
Nach Litfutur bin ich also weiterhin gespannt, welche Experimente gewagt werden, was ausprobiert werden wird, was Neues dazukommt – wobei das Ergebnis meines Erachtens nicht das entscheidende Kriterium sein wird. Denn auch wenn man auf die Nase fällt, lernt man im Prozess des Entstehens weiter dazu und mit den verschiedenen Möglichkeiten umzugehen. Insofern kann man nach Litfutur zuversichtlich sein: Wir werden Neues lernen, Kompetenzen entwickeln und bewegen uns eh jeden Augenblick am Rand des Nächsten.
Victor Kümel: Es gab einige für mich sehr interessante Positionen und Statements auf dieser Tagung zu hören, so zum Beispiel auch einen ersten exklusiven Einblick in das Start-Up Sobooks. Das Anliegen von Litfutur war aber nicht, Raum für Präsentation, sondern Raum für Reflexion zu bieten. Auf der Suche nach dafür geeigneten Formaten war es ein ergiebiges Labor, gerade auch in dem, was nicht funktioniert hat. Spannender als die Frage, wie man Irritationen zugunsten einer reibungslosen Performance vermeidet, finde ich deshalb in unserer Auswertung der Tagung auch die Frage, wie man diese Brüche und Unsicherheiten produktiv in den Reflexionsprozess rückkoppeln kann. Als erster Anstoß dieses Prozesses hat sich Litfutur allemal gelohnt.
Ein Kritikpunkt war: Viele Themen wurden nur oberflächlich gestreift, statt diskutiert. Müsste Litfutur nicht ein Medium anbieten, um die Debatte fortzuführen?
Guido Graf: Diese Kritik machen wir uns ja selbst zu eigen (siehe die obigen Stichwörter: Mutlosigkeit und Podiumsdiskussion) und werden in den nächsten Wochen genau das diskutieren: wie setzen wir die Debatte fort? Die Debatte darüber, wie und wo wir schreiben und lesen und publizieren und kommunizieren – und die Frage, wie wir andere, diejenigen, die das auch interessiert, daran beteiligen können – wie wir teilen. Die Welt wartet vermutlich gerade nicht auf ein weiteres Netzwerk, in dem alle sich verknüpfen können, die sich mit der Vermittlung von Literatur beschäftigen. Aber wenn es nicht die Welt ist, so doch vielleicht diejenigen, die ihre ästhetische Praxis und die Entscheidungen über diese Fragen selbst bestimmen wollen.
Jacob Teich: Litfutur war, wie gesagt, ein Anstoß. Und die Erfahrungen und (Selbst-)Kritik sind doch nur als Bereicherung wahrzunehmen: Wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht, Formate ausprobiert und dabei selbst gesehen, was funktioniert und was nicht. Mit diesem Material kann nicht nur der Diskurs fortgeführt, sondern eben auch die Praxis bereichert werden. Ich bin mir sicher, dass sich daraus neue Veranstaltungen, Räume und Plattformen ergeben werden, die inhaltlich neue Schwerpunkte setzen und Themen vertiefen. Aber indem wir es ausprobiert haben, können wir jetzt viel besser sagen und überlegen, an welcher Stelle es neue Ideen und Innovationen braucht und wie diese vielleicht aussehen können.
Es wird weiterhin ein Prozess sein, der mit Litfutur ja keinen Abschluss und ein endgültiges Resultat finden sollte, sondern eine weitere Stimme, die ganz sicher auch in Zukunft durch verschiedene Veranstaltungen und Beiträge die Auseinandersetzung bereichern wird.











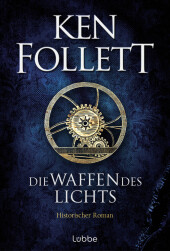
Kommentar hinterlassen zu "Litfutur: Relevant ist, was geteilt wird"