 Seit zwei Wochen kursiert im Internet ein Entwurf aus dem Justizministerium zur Reform des Urhebervertragsrechts. Bei Verlagen stoßen die geplanten Regelungen auf Kritik. Zu Unrecht, glaubt der Urheberrechtler Karl-Nikolaus Peifer. Der Entwurf des Ministeriums gehe in die richtige Richtung, teilweise aber nicht weit genug, meint der Direktor des Instituts für Medienrecht der Universität Köln im buchreport-Interview.
Seit zwei Wochen kursiert im Internet ein Entwurf aus dem Justizministerium zur Reform des Urhebervertragsrechts. Bei Verlagen stoßen die geplanten Regelungen auf Kritik. Zu Unrecht, glaubt der Urheberrechtler Karl-Nikolaus Peifer. Der Entwurf des Ministeriums gehe in die richtige Richtung, teilweise aber nicht weit genug, meint der Direktor des Instituts für Medienrecht der Universität Köln im buchreport-Interview.
Viele Buchverlage arbeiten mit dünner Kapitaldecke und schmalen Gewinnmargen. Wie stichhaltig ist vor diesem Hintergrund mit Blick auf die Buchbranche die Begründung, es gebe „unangemessen niedrige Vergütungen“ von Urhebern?
Urheber und Verwerter weisen gleichermaßen und zu Recht darauf hin, dass geistige Leistungen angemessen vergütet werden müssen. Diese Forderung wird in der digitalen Welt kaum durchsetzbar sein, wenn sich der Eindruck verstärkt, allein die Urheber müssten ihre Beiträge gratis oder unangemessen vergütet zur Verfügung stellen. Forderungen nach unbezahlter Werknutzung werden von Verlegern zu Recht bekämpft. Was man selbst fordert, sollte man denjenigen, die am Beginn der kreativen Verwertungskette stehen und ohne die es diese Verwertung überhaupt nicht gäbe, nicht vorenthalten. Der Referentenentwurf kommt den von Ihnen genannten Befürchtungen dadurch entgegen, dass er keine Grundsicherung für kreative Tätigkeit fordert, sondern die Durchsetzung einer angemessenen Beteiligung an wirtschaftlichen Vergütungen bei der Werknutzung. Das ist nicht neu, sondern bereits seit 1965 ein Grundsatz des deutschen Urheberrechtsgesetzes und auch die Verlage haben dieses Modell zu Recht stets für das richtige Konzept gehalten. Die sinkenden Erträge im klassischen Verlagsgeschäft können durch neue Geschäftsmodelle kompensiert, vermutlich sogar erheblich übertroffen werden. Um das zu ermöglichen, muss die Überzeugungskraft für die Grundidee des Urheberrechts – angemessene Vergütung für kreative Werke – erhalten bleiben.
Fürchte n Buchverlage nicht zurecht, das geplante Rückrufsrecht nach 5 Jahren würde die bisher praktizierte Mischkalkulation unmöglich machen?
n Buchverlage nicht zurecht, das geplante Rückrufsrecht nach 5 Jahren würde die bisher praktizierte Mischkalkulation unmöglich machen?
Der Referentenentwurf wie auch der „Kölner Entwurf“, der ihm vorausging, fußen auf der Idee, dass die vertragliche Position des Urhebers individuell gestärkt werden muss, solange es keine kollektiven Gesamtlösungen gibt, die zwischen Vereinigungen von Werknutzern und Urhebern „auf Augenhöhe“ ausgehandelt wurden. Diese kollektiven Mechanismen stehen durchaus zur Verfügung, um branchenspezifische Besonderheiten abzufedern. Dass dies gelingen würde, war die übereinstimmende Botschaft der Medienwirtschaft bereits im Jahr 2002. Leider ist diese Überzeugung in vielen Bereichen noch nicht umgesetzt.
In der Sache ist es richtig, dem Urheber in einer sich schnell wandelnden digitalen Welt mehr Kontrolle über die Verwertung seines Werkes zu geben, ihm also auch die Partizipation an neuen Geschäftsmodellen zu ermöglichen, die sein bisheriger Verwerter selbst nicht oder nicht ausreichend realisiert. Es mag Fälle geben, in denen ein Werk jahrelang in den Regalen liegt und erst dann vom Publikum „entdeckt“ wird. Den Normalfall dürfte das nicht darstellen.
Das Rückrufsrecht, welches der Referentenentwurf vorsieht, ist gegenüber dem Vorschlag des „Kölner Entwurfes“ bereits erheblich abgeschwächt worden, was wir durchaus mit Sorge sehen. Es dürfte den Verleger aber entsprechend geringer belasten, denn zum einen muss der Urheber selbst tätig werden, was er nicht tun wird, wenn er mit seinem bisherigen Verwerter zufrieden ist. Zum anderen muss er einen neuen Verwerter gefunden haben, der angemessenere Bedingungen der Verwertung in Aussicht stellt. Schließlich behält der neue Verwerter die Option, das Werk weiterhin im Bestand zu behalten, wenn er sich auf die Bedingungen einlässt, die der neue Verwerter bietet.
Eröffnet das Rückrufsrecht nicht finanzstarken Verlagskonzernen eine bequeme Möglichkeit, kleine Verlage durch Abwerben der erfolgreichen Autoren vom Markt zu drängen?
Auch finanzstarke Konzerne stehen vor dem Problem der Mischkalkulation. Auch sie müssen kalkulieren, ob es sich lohnt, den Urheber „herauszukaufen“, worauf der Rückruf letztlich hinausläuft. Der Urheber soll über das Rückrufsrecht Kontrolle über die Werkverwertung zurückerhalten. Dieses Interesse schützt das Gesetz bereits bisher in besonderer Weise. Es durchzieht seine gesamte Struktur von der Entscheidung zur Veröffentlichung bis hin zum Grundsatz, dass im Zweifel Rechte beim Urheber verbleiben.
Führt das geplante Recht auf jährliche Rechnungslegung nicht zu unangemessen großem Aufwand bei den Verlagen?
Verlage verlangen auch von Sublizenznehmern und anderen Nutzern mehr und mehr Auskünfte über das individuelle Nutzungs- und Zugriffsverhalten. Verwertungsgesellschaften müssen diese Auskünfte künftig den von ihnen repräsentierten Rechteinhabern (auch Verwertern) geben. Hinzu kommt, dass die Geschäftsmodelle der Zukunft sich stärker an Nutzungen als an Trägermedien orientieren werden. Um Beteiligungen an den Nutzungen neuer Verbreiter, wie Amazon, Apple oder auch YouTube zu generieren, werden alle Beteiligten Auskunfts- und Rechnungslegungspflichten vereinbaren. Die dabei gewonnenen Daten an die Urheber weiterzugeben, wird im Ergebnis keinen deutlichen Mehraufwand darstellen, dafür aber Fairness in der Abwicklung bewirken. Hinzu kommt, dass bereits heute gesetzliche Auskunftsansprüche der Urheber an vielen Stellen bestehen, insbesondere wenn es um die Abrechnung nutzungsabhängiger Vergütungen geht. Verwerter müssen daher bereits seit langem Abrechnungssysteme vorhalten. In der EDV-gestützten und digital vernetzten Welt sind die Möglichkeiten, dies zu realisieren wesentlich erleichtert. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass sowohl der „Kölner Entwurf“ als auch der Referentenentwurf die Möglichkeit zu branchenspezifischen Abweichungen in kollektiven Vereinbarungen vorsieht.
Was soll das geplante Verbandsklagerecht bringen, wenn mit der Klage ja doch individuelle Verträge angegriffen werden müssen?
Das Verbandsklagerecht sorgt dafür, dass in Vergütungsvereinbarungen eingegangene Verpflichtungen erfüllt werden. Es wird für die Verwerter gänzlich folgenlos bleiben, wenn sie ihre diesbezüglichen Verpflichtungen schlicht erfüllen. Allerdings hätte das Verbandsklagerecht unbedingt flankiert werden müssen durch eine stärkere AGB-Kontrolle, die auch Strukturen von Vergütungsvereinbarungen betrifft. Das Risiko des „Blacklisting“, das der Referentenentwurf ausweislich seiner Begründung dämpfen möchte, bleibt, wenn die Verbandsklage nur um den Preis der Aufdeckung eines beschwerten Urhebers geführt werden kann. Die AGB-Kontrolle, die der „Kölner Entwurf“ in seinem § 11 Abs. 1 vorgeschlagen hat, würde dies nicht erfordern.
Urheberverbände beklagen, dass Verwerterverbände (z.B. der Börsenverein) sich auch in Zukunft den Verhandlungen über gemeinsame Vergütungsregeln entziehen können. Zu Recht?
Dieses Risiko besteht in der Tat. Der Referentenwurf sieht nicht vor, dass Verbände an Vergütungsverhandlungen teilnehmen müssen. Zwar wird vermutet, dass Verbände, die den überwiegenden Teil der Werknutzer repräsentieren, als zur Verhandlung ermächtigt gelten (§ 36 Abs. 2 Satz 2 Referentenentwurf. Dieser Ermächtigung kann aber durch Beschluss der Vereinigung die Grundlage wieder entzogen werden (ebenda). Damit wird der Entwurf die Ziele, die er verfolgt, nur schwer erreichen. Die Vorschläge der Initiative Urheberrecht gehen an dieser Stelle weiter, selbst der sog. „Münchener Entwurf“ sieht mehr Einigungszwang vor (dort § 36 Abs. 3 Satz 3 ME). Damit bleibt der Referentenentwurf unterhalb dessen, was offenbar Konsens ist.
Welche Lücken hat der Entwurf Ihrer Meinung nach?
Eine verbleibende Lücke ist, dass der Entwurf die seit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs stark geschwächte AGB-Kontrolle von Urheberrechtsverträgen nicht aufwertet. Die im Kölner Entwurf geforderte Strukturkontrolle (dort § 11 Abs. 2 KE) wird ebenso wenig übernommen, wie die zwingende Ausgestaltung der sog. Zweckübertragungsregel (§ 31 Abs. 5 UrhG). Beides würde – zusammen mit der Verbandsklagemöglichkeit – dafür sorgen, dass die Struktur von Urheberverträgen verbessert würde. Beides würde die Gefahr des „Blacklisting“ von individuell vorgehenden Urhebern erheblich dämpfen. Der Referentenentwurf sieht in dieser Gefahr richtigerweise einen Anlass für die Neuregelung, bleibt allerdings in dem Bemühen, das Risiko zu beseitigen, zaghaft.
Dagegen gehen die Verkoppelung von stärker urheberschützenden Normen mit der Möglichkeit, kollektiv branchenspezifische Sonderregeln auszuhandeln (das im „Kölner Entwurf“ sogenannte „Anreizmodell“, das partiell auch im „Münchener Entwurf“ vorgesehen wird, vgl. dort § 36 Abs. 3 S. 3 mit Erläuterung S. 17 rechte Spalte) in die richtige Richtung. Insgesamt verbessert der Entwurf die Situation der Urheber, was zu begrüßen ist.
Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer ist Direktor des Instituts für Medienrecht und Kommunikationsrecht der Universität zu Köln und Mitverfasser des „Kölner Entwurfs“ zur Reform des Urhebervertragsrechts.
Die Fragen stellte David Wengenroth
Lesen Sie mehr zu Inhalt und Hintergründen des Referentenentwurfs zum Urhebervertragsrecht im aktuellen buchreport.express. Hier geht’s zum Abo.










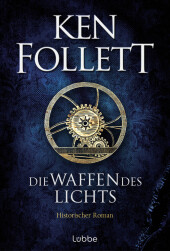
Vielen Dank für das Interview, das die Diskussion sicherlich beleben wird. Peifers Grundannahme lautet also: „Die sinkenden Erträge im klassischen Verlagsgeschäft können durch neue Geschäftsmodelle kompensiert, vermutlich sogar erheblich übertroffen werden.“ Diese Behauptung würde deutlich an Überzeugungskraft gewinnen, wenn noch verraten würde, wie diese neuen Geschäftsmodelle aussehen sollen und warum sie bislang nicht gefunden wurden. Zudem bleibt offen, warum eine anscheinend auf Umverteilungen angelegte Novelle bereits in einem Moment kommen soll, in dem die Erträge der Verwerter gerade nicht steigen.
Nicht nachvollziehen kann ich die Aussage, dass auch diejenigen „finanzstarken“ Unternehmen, die nach fünf Jahre ausschließlich diejenigen Werke aufkaufen, die nach dem bisherigen Auswertungsverlauf aufgrund der Investitionen der ursprünglichen Vertragspartner der Urheber unverminderten Erfolg erwarten lassen, vor dem „Problem der Mischkalkulation“ stünden. Was müsste z.B. Amazon mischen, wenn kleinen Verlagen reihenweise Rechte an Buchtiteln weggekauft würden, deren Verkaufskurven man über fünf Jahre in allen Produktformen studieren konnte?
Zur vorgeschlagenen Pflicht jährlicher Abrechnungen auch gegenüber pauschal abgefundenen Urhebern und Erbringern untergeordneter Kreativleistungen heißt Peifers Antwort: „Die dabei gewonnenen Daten an die Urheber weiterzugeben, wird im Ergebnis keinen deutlichen Mehraufwand darstellen“ Woher weiß er das? Aus welchen empirisch abgesicherten Quellen schöpft er Erkenntnisse, die kein Verlagspraktiker aus seiner eigenen Erfahrung nachvollziehen kann?
Glaubt man Peifer, dann ist das „Blacklisting“ von Urhebern bei Medienunternehmen geradezu ein Volkssport und eine Gefahr, die dringend durch den Gesetzgeber gedämpft werden muss. Auch hier wäre es hilfreich, wenn eine solche Aussage auf empirische Erkenntnisse, mindestens aber auf schlagende Beispiele gestützt werden könnte. Ansonsten bleibt der Verdacht, dass ein echter Diskurs über das Urhebervertragsrecht schon deshalb nicht entstehen kann, weil die Welt, in der die betroffenen Unternehmen agieren müssen, eine ganz andere ist als diejenige, die Köpfe und Bäuche in Elfenbeintürmen besetzt.