
(Foto: 123rf.com/alexandersikov)
Die Fähigkeiten von Organisationen und Einzelnen, im digitalen Geschäft mitzuspielen, werden zusammengefasst unter dem Begriff „Digital Readiness“. Doch wie erlangt man die digitale Kompetenz und welche Hindernisse stehen ihr entgegen? Welche Konzepte und Skills lassen sich unter „Digital Readiness“ fassen?
Der Selbsttest „Digital Readiness Check“ der Berliner Unternehmensberatung XU Group gibt Aufschlüsse hierüber und vergleicht den persönlich erreichten Stand mit der Gesamtheit der Getesteten. XU-Geschäftsführerin Nicole Gaiziunas beschreibt im Channel Produktion & Prozesse von buchreport.de den Rahmen.
Ready or not?
Digital Readiness – der Begriff ist mindestens so alt wie die Digitalisierung selbst und damit, in unserer schnelllebigen Zeit, uralt. Alle sprechen davon, aber nur wenige verstehen, was gemeint ist und vor allem welche Konsequenzen eine mangelnde Digital Readiness für den beruflichen Alltag und den Erfolg der digitalen Transformation hat. Dabei begegnen uns diese Konsequenzen Tag für Tag. Denn täglich sagen uns der Markt, der Wettbewerb, die Konkurrenz, die eigenen Kundinnen und Kunden, die Expertinnen und Experten, die Politikerinnen und Politiker und die Systemlieferantinnen und -lieferanten: Digitalisiert!
Klammern wir für einen Moment die Besserwisserinnen und Besserwisser sowie die Digitalisierungsleugnerinnen und -leugner aus, die diesen Imperativ nicht hören wollen oder können – oder wie John Heywood sagte: „There are none so blind as those who will not see.“ Vergessen wir für einen Moment jene, die nicht sehen wollen. Konzentrieren wir uns lieber auf jene Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Managerinnen und Manager, die sehen, hören und digitalisieren wollen.
Sie werden jeden Tag aufs Neue mit Technologien wie Cloud Computing, Künstlicher Intelligenz (KI), Silicon Economy, Robotisierung, Smart Data und Autonomisierung konfrontiert und setzen sich auch konstruktiv damit auseinander. Das heißt, sie erkennen: Wir müssen das machen! Wir müssen digital(er) werden! Picken wir ein Beispiel heraus: Ein großes Handelsunternehmen erahnt die Möglichkeiten der Effizienzsteigerung, die der Einsatz einer KI im Rechenwesen bietet. Die Technik ist da, sie ist ausgereift, die internationale Konkurrenz springt bereits auf – also muss das Handelsunternehmen den Anschluss wahren. Doch für eine KI-Implementierung reicht das Bordwissen des Konzerns noch nicht aus. Was machen Unternehmen in so einem Fall?
Sie holen sich externe Expertise ins Haus. Wie? Sie schreiben einen Beratungsauftrag aus und schon tappen Sie in eine Falle – ohne dass das jemand mit Vorstandsrang bemerkt. Vergleichen lässt sich das mit einem Autokauf: Die Prämisse „Ich brauche ein Auto“ führt als „Ausschreibung“ nicht unmittelbar zu einem erfolgreichen Autokauf, sondern kann direkt ins Desaster führen. Denn ein Familien-Van ist ebenso „ein Auto“ wie das Zweisitzer-Cabriolet und dutzende Pkw-Typen zwischen diesen beiden Polen des Spektrums. „Ein Auto“ ist keine valide Ausschreibung. Ergo: Wer nicht „ein Auto“ braucht, sondern genau jenes Auto, das zum eigenen Bedarf passt, sollte bereits bei der Ausschreibung mehr von Autos und davon verstehen, wozu genau es gebraucht wird. Denn sonst melden sich sowohl Van- als auch Cabrio-Verkäufer und machen Angebote.
Genau das passiert vielen Unternehmen – allerdings nicht beim Autokauf für die eigene Firmenwagenflotte. Dabei wird die Ausschreibung oft seitenweise und bis auf den zweiten Getränkehalter für Beifahrer spezifiziert. Das gilt aber leider nicht für Ausschreibungen für digitale Technologien und insbesondere für die dafür nötige Beratung. Nehmen wir an, das passiert auch unserem diskutierten Handelsunternehmen. Mit welcher Konsequenz? Es wird unter Beratungsangeboten begraben, die nach dem Massenware-Prinzip erstellt sind: unspezifisch und ungeeignet.
Eine der Managerinnen zieht den korrekten Schluss: „Es wäre besser gewesen, wir hätten bereits vor der Ausschreibung etwas über KI im Rechenwesen gewusst.“ Das war nicht der Fall. Warum? Weil der entsprechende Reifegrad noch nicht erreicht wurde. Resultat: „Die Ausschreibung und die daraufhin eingelaufenen Angebote können wir komplett in den Papierkorb werfen.“ Eine andere Managerin im selben Konzern sagt: „Es wäre gut gewesen, wenn sich mindestens eine Abteilung bereits mit Künstlichen Intelligenzen ausgekannt hätte.“ Hört sich wie der Ausweg aus der Falle an, ist es aber leider nicht.
Es reicht nicht, wenn einer sich auskennt
Leider fällt der Konzern auch auf diese Pseudolösung herein: „Eine Abteilung muss in den Lead gehen!“ Hört sich gut an. Logisch. Zielführend. Bewährt in vielen anderen Vorhaben. Der Denkfehler: Bewährt in analogen Vorhaben. Weil jedoch niemand den Fehler bemerkt, erbarmt sich tatsächlich ein Fachbereich: Das Rechnungswesen geht in den Lead, verschafft sich das nötige Anfangswissen und erreicht damit eine deutlich größere Digital Readiness. Als wer? Das ist die entscheidende Frage.
Die Antwort lautet: Als alle anderen Fachbereiche und der Vorstand. Warum sollte das nicht gut sein? Genau das wollte man doch erreichen! Doch wie schon oft thematisiert, ist Digitalisierung kein Soloflug, kein „Superman rettet die Welt!“-Projekt aus dem Comic-Universum, sondern ein Team Effort, ein Mannschaftssport. Das stellt sich im betrachteten Konzern auch schnell heraus. Als das Rechnungswesen für alle anderen Funktionsbereiche sozusagen in Führung geht, voranschreitet, seine überlegene Digital Readiness ausspielt und allen anderen zeigt, wie das Ganze umgesetzt werden kann, wo das Licht am Ende des Tunnels ist, sagt ein Drittel der anderen Abteilungen: „Ihr könnt uns viel erzählen!“ Ein weiteres Drittel meint: „Das mag ja alles sein, aber das passt so nicht bei uns.“ Und wieder kommt die Digitalisierung zu einem knirschenden Halt, obwohl die Lead-Abteilung es gut gemeint hat.
Zu spät erkennt der Vorstand: „Es reicht nicht, wenn eine Abteilung es besser weiß (und viele andere ihr nicht glauben). Im Prinzip braucht mindestens ein Viertel unserer Belegschaft eine Grundbefähigung bei der jeweils diskutierten Technologie – und zwar quer durch alle Fachbereiche.“ Das ist tatsächlich eine gute Faustregel für die kritische Masse (mehr ist natürlich besser). Bis der Konzern diese kritische Masse dank eines massiven Trainingsprogramms erreicht, vergehen neun Monate. Neun Monate, in denen die Konkurrenz schon weit voraus ist – weil sie früher und großflächiger in die Digital Readiness der kritischen Masse ihrer Belegschaft investiert und die entsprechenden Trainingsprogramme aufgelegt und implementiert hat. Wer früher trainiert, ist früher am Ziel. So einfach ist das manchmal – leicht ist es nicht.
Neun Monate braucht der Konzern, bis alle Fachbereiche mit ihrer Fachkenntnis so weit sind, dass das Thema „KI im Rechenwesen“ überhaupt bereichsübergreifend und vor allem sachgerecht diskutiert werden kann – implementiert ist da noch kein Jota. Warum dauert das so lange?
Beton für die Falle
Die meisten Raucher, Übergewichtigen, Spielsüchtigen oder auch Streaming-Enthusiasten wissen, dass sie sich mit ihrer Sucht nichts Gutes tun. Leider geben die meisten Raucher das Rauchen deshalb nicht auf. Warum? Weil die „Gründe“ dafür stärker sind als die Gründe dagegen: Für jede Falle, in der Menschen oder Unternehmen stecken, gibt es „gute“ Gründe, die sie in dieser Falle festhalten.
Bei der Digital Readiness zum Beispiel geschieht das mit Managementmentalitäten wie: „Ach, das nötige Wissen haben unsere Fachabteilungen doch!“ Weil sie sich in der Vergangenheit sämtliche neuen (analogen) Technologien auch ohne offizielle Schulungsprogramme angelernt hatten. Das funktionierte vor der Digitalisierung mehr schlecht als recht mit analogen Technologien – mit der Digitalisierung funktioniert es nicht mehr: zu komplex, zu viel, zu schnell, zu digital.
Ein anderer Beton-Glaubenssatz ist: „Wenn sich unsere IT damit auskennt, kann sie es ja den anderen Abteilungen beibringen.“ Also jene IT-Experten, die in anderen Fachabteilungen seit Jahren als „abgehobene Nerds, die kein Mensch versteht“ stigmatisiert sind, sollen jetzt die Lehrkräfte für das ganze Unternehmen spielen? Nichts gegen die ITler – das sind alles hoch spezialisierte Experten. Aber eben für den Bereich IT, nicht für Didaktik und Methodik.
Eine weitere Art von Beton, der Unternehmen in der jeweiligen Falle zementiert, ist die grundlegende Unkenntnis darüber, wie lebenslanges Lernen oder das lernende Unternehmen bzw. Lernen per se funktioniert: nicht von allein, automatisch und keinesfalls auf Anweisung. Keine Mitarbeitende und meist auch keine Führungskräfte, die eine funktionierende Work-Life-Balance schätzen, erwerben sich die für die Digitalisierung nötigen Fachkenntnisse nach Feierabend oder am Wochenende. Wer möchte, dass die Belegschaft das Digitale erlernt, sollte ihr die Möglichkeit(en) dafür bieten. Selbst dann ist Lernen noch kein Selbstläufer.
Diese und andere lernfeindliche Beton-Glaubenssätze sind leicht zu identifizieren. Schließlich kennt jeder im Unternehmen die geheimen Spielregeln der Firma. Sie sind augenfällig, jedoch schwer zu ändern – wie das Rauchen auch. Dafür bieten Rauchen und geheime Spielregeln zu viele Vorteile. Der größte Vorteil von lernfeindlichen Glaubenssätzen bei der Digitalisierung: Bequemlichkeit. Man muss nichts machen. Vor allem muss man nicht lernen. Lernen erinnert die meisten Menschen unangenehm an die eigene Schulzeit (der volkswirtschaftliche Schaden unseres Schulsystems geht in die Milliarden – jährlich). Wer diese Bequemlichkeit mehr schätzt als seine Digital Readiness, sollte bequem bleiben. Warum bleiben jene, die digital ready sind, nicht bei dieser Bequemlichkeit?
Weil die Festzementierten nur die Nachteile des Lernens sehen. Den Riesenvorteil übersehen sie: Lernen macht Spaß und bringt Erfolg! Doch das sehen jene nicht, die ein ganz bestimmtes Problem mit dem Lernen haben: Status.
 Der Channel Produktion & Prozesse
Der Channel Produktion & ProzesseWeitere Lösungen, Impulse und Erfahrungsberichte für die Verlagsproduktion lesen Sie im Channel Produktion & Prozesse von buchreport und Channel-Partner Publisher Consultants.
Hier mehr…
Die größte Lernblockade: Statusangst
Es gibt Menschen, die gehen lieber in die Zahnarztpraxis als in einen Schulungsraum. Warum? Wenn man sie fragt, kommt meist eine Rationalisierung: „Keine Zeit!“, „Das Thema ist für mich nicht relevant!“, „Ich kann nicht zur Schulung, ich habe ein wichtiges Kundengespräch!“.
Schafft man es durch geduldiges Nachfragen, diese Kulissenantworten zu hinterfragen, kommt in der Nähe eines Tiefeninterviews dann in aller Regel heraus: Viele Führungskräfte und Mitarbeitende haben Angst. Vorm Lernen. Statusangst.
Das ist für wissbegierige Menschen nicht nachvollziehbar, aber für Statusbewusste ergibt das Sinn. Sie erklären einem das auch schlüssig: „Wer etwas lernt, gibt damit zu, es nicht zu können.“ Und das kann ein prononciert statusbewusster Mensch weder sich noch anderen eingestehen. Dieser Mensch kann nicht einmal andeutungsweise zugeben, dass er etwas nicht weiß oder kann, denn das wäre eine Schwäche und damit ein Statusverlust. Wer nach diesem unterbewussten und unreflektierten Lebensmotto lebt, fürchtet neues Wissen stärker als der Teufel das Weihwasser und blockiert oder verzögert zumindest alle Lernversuche seines Teams. Gutes Zureden hilft da nicht, weil dieser mentale Zustand der Verweigerung hoch neurotisch und damit veränderungsresistent ist – und kein Vorgesetzter und keine Vorgesetzte den dafür nötigen Therapieauftrag haben. Vorgesetzte sind keine Therapeuten.
Da hilft nur noch was? Die Anweisung von oben: „Für diese Maßnahme der Kompetenzentwicklung besteht Anwesenheitspflicht. Auch für Führungskräfte. Keine Ausnahmen. Anwesenheit wird kontrolliert.“ Anweisung „kuriert“ Statusangst, zumindest fallweise kurzfristig. Das leuchtet ein. Doch wenn ich sehe, wie viele Führungskräfte sich vor digitalen Schulungsmaßnahmen drücken, wird schnell klar, dass in etlichen Unternehmen diese Anweisung von oben ausbleibt (oder ignoriert wird, was einem gravierenden Autoritätsverlust der Führung gleichkommt). Und wegen dieses Absentismus scheitert dann die digitale Transformation oder wird stark ausgebremst.
Wenn es solche Lernkiller gibt, gibt es dann auch das Gegenteil? Gibt es.
Der Lernturbo: O wie Offenheit
Manche Menschen sind Neuem gegenüber zunächst skeptisch: „Erst mal abwarten, wie sich das entwickelt“, „Das setzt sich sicher nicht durch“, „Das passt bei uns nicht“, „Das haben wir doch schon mal probiert und es hat nicht geklappt“.
Skepsis ist die Bewältigungsstrategie unsicherer oder extrem statusbewusster Naturen. Wer unsicher ist, lernt nichts oder nur ungern hinzu. Wer unsicher ist, ist nicht offen für Neues. Offen ist, wer sagt: „Das könnte doch auch bei uns funktionieren.“, „Mal sehen, was für uns dabei drin ist.“, „Lass uns das einfach mal probieren!“ Das ist mentale Beweglichkeit.
Viele halten Offenheit für eine Charaktereigenschaft. Das ist sie nicht, sie scheint bloß so, weil sie so überaus charismatisch und prägend wirkt. Tatsächlich ist mentale Beweglichkeit wie auch die physische Beweglichkeit eine Fähigkeit, wenn nicht eine Entscheidung: Wir können uns jederzeit dazu entschließen, dem Neuen erst einmal eine Chance zu geben; sozusagen auf Vorschuss. Viele Führungskräfte machen das: „Leute, bitte gebt dem Ganzen eine Chance!“ Es hat seine Wirkung, wenn Vorgesetzte das sagen. Besser jedenfalls, als wenn sie nichts sagen oder selbst Skepsis zeigen: „Ich weiß nicht, wie wir das alles neben unserer eigentlichen Arbeit auch noch schaffen sollen!“ Man sollte es einfach mal probieren und nicht gleich negativ sein.
Die Kompetenzillusion: Dunning-Kruger-Effekt
Wenn wir den Zement diskutieren, der Unternehmen in der 40. Falle festhält, dürfen wir auch die Kompetenzillusion nicht vergessen.
80% der Autofahrerinnen und -fahrer halten sich für überdurchschnittlich gut – was rein mathematisch unmöglich ist, jedoch ein schönes Beispiel für die Kompetenzillusion, auch „Dunning-Kruger-Effekt“ genannt: Viele Menschen mit Kompetenzdefiziten halten sich für überdurchschnittlich kompetent. Oder wie eine junge Managerin der Pharmabranche es formuliert: „Wer schon nichts draufhat, sollte sich zumindest schwer was darauf einbilden!“ Als ob das Absicht wäre!
Tatsächlich ist es das nicht; der Spott ist also nicht gerechtfertigt. Dunning-Kruger ist vielmehr ein echter Bias, eine vorsatzlose kognitive Verzerrung, ein ehrlicher Denkfehler: Menschen, die sich irrtümlich für super kompetent halten, sind keine Angeber. Sie glauben wirklich, sie seien super kompetent.
Dunning-Kruger führt dazu, dass viele Führungskräfte ihre und die Digital Readiness ihres Teams, ihrer Abteilung und/oder ihres Unternehmens deutlich überschätzen. Sie glauben, digital bereits weiter zu sein, als sie es tatsächlich sind, weil sie ihrem Bauchgefühl vertrauen. Das legendäre Bauchgefühl hat seine Verdienste, liegt jedoch beim Digitalen meist daneben, weil das Digitale so neu und so komplex ist, dass nur wenige Führungskräfte dazu schon eine verlässliche Intuition haben ausbilden können. Dabei wäre die Desillusionierung der Kompetenzillusion so einfach: Es gibt inzwischen viele verlässliche Digital Readiness Checks oder Readiness Assessments, einige davon sogar digital, also online.
In allen Fällen von Dunning-Kruger bieten wir den Betroffenen so einen Test an. Und was passiert? Das ist gerade das Vertrackte an der Kompetenzillusion: Wer der Kompetenzillusion erliegt, tut es deshalb, weil er die Illusion nicht als solche erkennt – und lehnt den Readiness-Test ab: „Wieso testen? Wir können das doch schon alles!“ Und von da an geht’s bergab. Deshalb sagen smarte Führungskräfte: „Okay, testen wir das – dann wissen wir wenigstens, woran wir sind!“ Manche bieten sogar eine Wette auf die eigene Kompetenz an – das sind die besonders kompetitiven Typen. Also testen wir.
Das muss noch nicht einmal ein Test der kompletten Belegschaft sein. Es reichen bereits Pilot-Tests in ausgewählten Bereichen und Abteilungen für eine verlässliche erste Aussage über die Digital Readiness. Was testen wir? Die technische Kompetenz der Befragten, ihre Kompetenz in digitalen Methoden und ihre Agilität, die digitale Kultur, ihre Datenkompetenz und die Kommunikation. Mit den Testfragen ermitteln wir Antworten auf drei zentrale Fragen:
- Wissen: Was wissen Führungskräfte und Mitarbeitende über die relevanten digitalen Themen?
- Qualifikation: Welche Kompetenzen haben sie dafür?
- Handlungsfähigkeit: Was tun sie konkret damit?
Den Test gibt es in den beiden Versionen „Basic“ und „Advanced“, da man Anfänger bei der Digitalisierung nicht mit Fragen für Fortgeschrittene er- und abschrecken sollte.
Was kommt bei so einem Test heraus? Betrachten wir wieder das Beispiel des Handelsunternehmens.
Tests lügen nicht
Bei der technischen Kompetenz der Befragten kommt im Schnitt immer dasselbe Ergebnis heraus – was kein Wunder ist. Denn die digitalen Technologien sind so neu, dass sich nur Spezialkräfte damit auskennen. Daher fällt auch das Testergebnis beim Handelskonzern ernüchternd aus: Seine digitale Reife liegt zum Beispiel bei der digitalen Technik je nach Teilgebiet zwischen 10 und 30%. Als wir ihnen dieses Ergebnis zeigen, reagieren einige Führungskräfte leicht geschockt. Andere denken mit.
Eine von ihnen fragt: „Ab wann beginnt denn die digitale Reife?“ Gute Frage. Sie beginnt jenseits der 50%, also umgangssprachlich gesagt „jenseits von Halbwissen“. Ab 70% sprechen wir von einer guten Kompetenz und die Klassenbesten erreichen 80% und mehr. Solche Unternehmen gibt es schon. In jeder Klasse gibt es praktisch mindestens einen Klassenbesten; so funktioniert das Klassensystem nun mal. Genau das ziehen jedoch viele Führungskräfte nicht in Betracht, wenn sie unter Dunning-Kruger leiden – und die Zeitbombe tickt.
Diese Zeitbombe besteht darin, dass es bereits heute in fast allen Branchen Digital Leader gibt. Klassenbeste, die über eine hohe technische Kompetenz verfügen. Gib diesen Digital Leadern noch fünf Jahre, in denen sie ihre Führerschaft voll ausbauen, die Vorreiter-Dividende einfahren und ihre Marktstellung explosionsartig vergrößern – und die meisten anderen Branchenunternehmen können einpacken. Das sage nicht ich, das sagt das Marktgesetz: Schnell frisst langsam; kein Entrinnen. Doch zurück zu unserem Beispielunternehmen: Es liegt, wie gesagt, in vielen Bereichen der technischen Kompetenz bei 10 bis 30%. Das heißt, jetzt wird mächtig Grundlagenwissen gelernt.
Das Gute an solchen Readiness-Tests ist: Anhand der Ergebnisse sieht man ganz genau, wo was mangelt, und kann dann exakt die aufgedeckten Wissenslücken auffüllen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das heißt: Man ist nicht dazu verdammt, im Blindflug „Grundlagen der Digitalisierung“ zu ordern, wobei dann unweigerlich auch viel an Wissen vermittelt wird, das mit den 10 bis 30% bereits vorhanden ist. Tests ermöglichen zielgenaue und damit hoch effiziente Trainings: Trainiert und bezahlt wird nur das, was tatsächlich benötigt wird – und nicht das, was Coaches an „Standardprogramm“ vermitteln.
Was Tests noch alles aufdecken
Ein guter Readiness-Test wird immer auch eine Antwort auf die Frage geben: Welche digitalen Themen sind akut im Unternehmen? Aus der Erfahrung können wir sagen, dass es meist dieselben sind: digitale Technologien (KI, Autonomisierung …), Datenkompetenz, digitale Innovationsfähigkeit, neue digitale Geschäftsmodelle, aber auch die digitale Optimierung oder Neukonzipierung von vorhandenen Geschäftsprozessen.
Wird auch das Management getestet – warum sollte es ausgenommen sein? –, zeigt sich in vielen Unternehmen ein strategisches Defizit. Ein Beispiel: Wir testen 237 Führungskräfte eines großen Unternehmens. Bemerkenswert an sich ist bereits, dass eine Geschäftsleitung ihr komplettes Management testen lässt: In solchen Unternehmen ist die Statussucht (s.o.) nicht vorhanden oder nur schwach ausgeprägt. Wer sich testen lässt, ist weniger an Status und mehr an Leistung und Ergebnis interessiert. Eines der Ergebnisse, das den Vorstand irritiert: 20 Jahre nach „Erfindung“ der Digitalisierung ist eine nennenswerte digitale Strategiekompetenz im Managementteam praktisch nicht vorhanden. Oder wie es die Basis kommentiert: „Dann müssen wir uns ja nicht länger wundern, warum das mit der Digitalisierung bei uns nur so schleppend vorangeht!“ Gewiss, das Testergebnis ist schockierend – und auch wieder nicht. Denn bislang ging jeder mehr oder weniger davon aus, dass die Digitalisierung strategisch zumindest eingenordet ist. Der Test zeigt: nein. Und seit diesem Testergebnis steht die Digitalstrategie im Fokus des Vorstands, was schnell Wirkung im Management zeigt.
Und natürlich: die digitalen Methoden. Davon haben alle Führungskräfte inzwischen schon etwas gehört. Doch etwas davon gehört zu haben heißt noch nicht, auch etwas davon zu verstehen oder gar effizient anzuwenden. An dieser Stelle fragen in Beratungen, Workshops oder Coachings dann jene, die mitdenken: Von welchen digitalen Methoden sollten Führungskräfte heutzutage zumindest die Grundlagen verstehen, damit sie mitreden und mitdenken können? Eine gute Frage. Unsere Antwort der unabdingbaren Pflichtmethoden:
- Customer Centricity
- Agile Methoden wie Sprint, Scrum, SAFe oder LeSS
- Stand-up, OKR (Objectives and Key Results)
- Kanban-Boards
- Retrospektiven: Man schaut nach Projekten, Maßnahmen oder einfach nur nach definierten Zeitabschnitten regelmäßig zurück: Was war die Herausforderung und wie haben wir sie gemeistert?
Warum taucht „digitale Transformation“, das Modewort unserer Zeit, nicht mehr in dieser Aufzählung auf? Weil die aktuelle Entwicklung schon seit einigen Monaten darüber hinweg ist. Dass Führungskräfte heutzutage digital transformieren können, gilt als Selbstverständlichkeit. Wobei mir bewusst ist, dass diese Selbstverständlichkeit in vielen Unternehmen eben nicht gegeben ist – sonst wären wir nicht hier, sonst gäbe es nicht so viele Führungskräfte und Unternehmen, die in Fallen feststecken.
Weitere be(un)ruhigende Ergebnisse
Wir haben gesehen, dass viele Unternehmen noch recht schwach bei der digitalen technologischen Kompetenz abschneiden. Recht gut sind die Testergebnisse im Schnitt der Branchen dagegen bei den zentralen Themen Digital Leadership, Digital Culture und Kommunikation. Oder wie es die Geschäftsführerin eines großen Mittelständlers ausdrückt: „Bei den soften Themen sind wir wohl ziemlich gut!“ Ja, doch ich würde sie nicht „soft“ nennen. Wir haben zur Genüge gesehen, was Kommunikationspathologien, Führungsversagen oder eine Unkultur der mangelnden Offenheit gegenüber Neuem anrichten können. Doch wir können auf jeden Fall sagen: Diese guten Testergebnisse zeigen, dass die Unternehmen, die so gut abschneiden, sich mit diesen essenziellen Themen stark auseinandergesetzt haben und sich auch weiter damit auseinandersetzen. Gut, diese Themen sind etwas einfacher als die technologischen Themen – aber immerhin.
Bei vielen anderen Themen jedoch stellen wir eine fatale Diskrepanz fest: Beim Wissen und bei der Qualifikation schneiden etliche Testpersonen mit fast 100% ab, bei der entsprechenden Handlungsfähigkeit jedoch oft nur mit 10%. Warum? Weil Wissen und Können etwas anderes sind als Umsetzung. Ganz gleich, wie viel man weiß und kann – man muss es immer noch umsetzen. Wissen und Können sind kein Ersatz für Taten.
Es gibt inzwischen viele gute, das heißt lerntransfergesicherte, digitale Lernprogramme, mit denen man sich das ganze digitale Wissen aneignen kann. Auf diese Weise erwerben Lernende auch unzweifelhaft gute Kompetenz. Doch für die konkrete Umsetzung von Wissen, Kompetenz, digitalen Innovationen und Geschäftsmodellen braucht es ein anderes Mindset.
Ein Mindset, das sagt: Das haben wir nicht nur in Online-Learning-Sitzungen gelernt, sondern das setzen wir mit konkreten Time Slots und Maßnahmenplänen jetzt auch in unserem Alltag um. Genau daran hapert es aus den bekannten Gründen: Zeitnot, „Aufträge kommen zuerst!“ oder „Wie kriegen wir jetzt das Ganze auf die Straße?“.
Was fehlt, ist Training. Das wissen viele nicht. Viele sehen sehr wohl: „Wir haben da ein Umsetzungsproblem. Wir wissen viel und können viel, aber wir setzen zu wenig davon um.“ Doch sie wissen oder sehen nicht: Anwendung ist nicht gottgegeben und kann auch nicht im nötigen Ausmaß „von oben herab“ angeordnet werden (zugegeben: eine harte Erkenntnis). Anwendung kann und muss trainiert werden. Die Methoden dafür: Shadow Coaching oder Peer Coaching (die Coaches laufen im Alltag der Führungskräfte mit – Turbo-Coaching, sozusagen).
Die anwendungsstarken Führungskräfte und Unternehmen kennen zudem einen „Trick“. Sie kontrollieren die Anwendung. What gets feedback, gets done. Das ist selbstverständlich? Das denken nur jene, die noch nie in einem Unternehmen gearbeitet haben. Denn in jedem normalen Unternehmen gilt:
»Macht mal!«
„Macht mal!“, sagt die Führungskraft – oft mit der Ergänzung: „Ihr habt mein volles Vertrauen!“ Und danach hört man nichts mehr von ihr. Kein Feedback. Kein Nachhaken, Nachfassen, Sich-updaten-Lassen, Am-Ball-Bleiben, keine Kontrolle. Bis auf das unvermeidliche Grollen nach verstrichener Zeit: „Warum zum Donnerwetter ist das noch nicht umgesetzt?“ Weil es nie nachgefasst, kontrolliert, mit Feedback versehen wurde.
„Ja, warum auch? Ich dachte, das läuft längst!“
Denken ist kein legitimer Ersatz für Managen oder Führen. „Aber wenn ich etwas anweise, dann muss das auch erledigt werden!“ Wo? Bei der Bundeswehr? In einer Organisation mit Befehl und Gehorsam?
Was früher der Befehl war, ist heute das Feedback: Ohne es passiert nichts. Ja, das ist ein radikaler Wertewandel, der jedoch wenig erstaunlich ist. Viel erstaunlicher ist doch, dass es immer noch feedbackindolente Führungskräfte gibt. Wie und mit welcher monumentalen Kraft der Verdrängung konnten sie bloß so lange überleben?
Wie machen das im Gegensatz dazu umsetzungsstarke Führungskräfte? Die sind „hinterher“, wie die Basis sagt, zum Beispiel: „Da ist unsere Chefin schon hinterher, dass wir das auch tatsächlich umsetzen. Da schaut sie drauf und erinnert uns gegebenenfalls daran, wenn wir das nicht schnell oder gut genug umsetzen.“ So wird das gemacht. Und wenn das so gemacht wird, dann wird auch gemacht, was angewiesen wurde.
Warum machen das nur so wenige Führungskräfte? Weil Feedbackindolenz in vielen Hierarchien als Kavaliersdelikt durchgeht, und das auf unbestimmte Zeit. Es sagt ja niemand den Vorgesetzten der Vorgesetzten, dass die Vorgesetzten kein Feedback geben. Wie auch? Zum Beispiel mit 360°-Befragungen. Damit und danach ist die Sache relativ einfach. Dann sagt zum Beispiel die Bereichsleiterin zur Abteilungsleiterin: „Wie kann das sein? 68% deiner (selbstverständlich anonymisiert ausgewerteten) befragten Mitarbeitenden sagen, dass du ’selten bis nie‘ Feedback gibst? Dann wiederholen wir die 360°-Messung doch gleich in vier Wochen. Bis dahin erwarte ich einen Wert unter 30%.“ Und plötzlich kann diese bislang „maulfaule“ Managerin Feedback geben.
Methoden wie die 360°-Befragung sind nötig, denn Mitarbeitende gehen nicht zu den Vorgesetzten der Vorgesetzten und sagen: „Unsere Vorgesetzten geben kein Feedback!“ Das traut sich niemand (einmal ganz davon abgesehen, dass es einem oft nur Ärger bringen würde). Mit 360°-Befragungen dagegen traut es sich jeder und immer. Vielleicht sind solche Befragungen deshalb so wenig in der Firmenlandschaft verbreitet. Wer sehr statusorientiert ist, erlaubt seinen „Untertanen“ nicht, ihn via 360°-Umfrage zu „beurteilen“ (eine Beurteilung ist das ja nicht). Wir erkennen wieder: Mit bestimmten Werten funktioniert die digitale Transformation einfach nicht. Überbetonter Status ist so ein Wert. Wie komplett anders das funktionieren kann, sehen wir in Start-ups, aber auch in einigen Start-ins (die nicht unabhängig, sondern von Unternehmen – sozusagen intern – selbst gegründet werden): Da sind Führungskräfte oft derart feedback-enthusiastisch, dass sie nie wieder eine Anweisung erteilen müssen. Ihr Enthusiasmus vermittelt sich via Feedback so exzellent, dass die Mitarbeitenden von selbst losrennen – man muss es ihnen nicht erst anweisen.
»Die machen das alles!«
Ein abschließendes Wort zur Digital Readiness, insbesondere zur integralen Handlungsfähigkeit: Vor einiger Zeit berichtete ein befreundeter Experte, dass er in seinen Beratungsgesprächen oft fast selbst einschlafe, weil: „Ich kann den meisten Klienten noch so eindringlich predigen, dass sie auf den Zug der Zeit aufspringen sollen – die hören zwar höflich und aufmerksam zu, lesen auch die Dokumentation und die Konzepte und bezahlen gut. Aber danach passiert meistens nichts.“ Er nennt das euphemistisch „Realisierungsstau“ – ein prägnanter Ausdruck.
Neulich kam er ganz begeistert von einem Termin bei einem neuen Kunden zurück und strahlte: „Ihr werdet es nicht glauben, aber das Management dort ist unglaublich! Die hören mir nicht nur zu. Die fragen mir Löcher in den Bauch und dann machen die das alles auch, was wir besprochen haben! Die setzen das um, kommen zurück und wollen mehr!“ Er war noch Tage später heillos begeistert. Ich war konsterniert.
Wenn wir uns schon über Unternehmen freuen, die tatsächlich umsetzen, was nötig ist – was sagt das über den Zustand unserer Wirtschaft?
Bereit fürs digitale Geschäft?
Welche Kompetenzen können Sie bzw. Ihre Mitarbeitenden noch ausbauen, um die Digitalisierung aktiv mitzugestalten? Hier der „Digital Readiness Check“.
Mit freundlicher Genehmigung der Haufe Group.

Nicole Gaiziunas: Die 44 Fallen der Digitalisierung… und wie wir alle sie vermeiden.
- Haufe, 1. Auflage 2021
- 215 Seiten
- Hardcover: 39,95 Euro
- E-Book (EPUB/PDF): 35,99 Euro


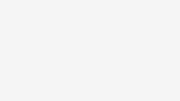








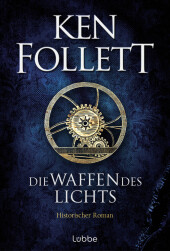
Kommentar hinterlassen zu "Sind Sie bereit fürs digitale Geschäft?"