Der Streit um Amazon in den USA und Deutschland ist Symptom einer säkularen Veränderung der Buchbranche. Der Appell an den Staat gegen die Internetgiganten wird nicht weiterhelfen: Die Impulse müssen aus der Gesellschaft kommen. Manifest für eine soziale Marktwirtschaft im Buch-Business.
Teil 1: Es geht ums ganze Ökosystem
Der Auftritt der Autoren, in Gestalt von öffentlichen Aufrufen erst in den USA, jetzt in Deutschland, und wohl demnächst auch in weiteren europäischen Ländern – schlägt ein neues, spannendes Kapitel auf in einem Streit, der anfangs als schnödes Gerangel um Rabatte und Lieferkonditionen bei digitalen Büchern zwischen Verlagen (also Produzenten) und Amazon (einem großen Händler) begonnen hatte.
Nun aber umfasst die Konfrontation alle Seiten – die Urheber, die Mittler und die lesenden Konsumenten. Es geht ums Eingemachte, im Wortsinn: Das gesamte Ökosystem aus Schreiben, Öffentlichmachen (das ist es doch: Verlegen und Publizieren!) und Lesen steht im Fokus der Debatte, und wie dies alles zurzeit neu geordnet wird – zuvorderst wirtschaftlich, doch nicht nur.
Beginnen wir bei den Autoren, ohne die es nicht viel zu verlegen, zu vertreiben und auch nicht zu lesen gibt.
Der (neue) Kampf der Autoren
Seit mehreren Jahren präsentieren sich Autoren, wenn es um die galoppierenden Umbrüche am Markt mit Büchern geht, als eine weitgehend geeinte (Berufs-) Gruppe, die in einem Boot sitze mit den Verlagen, ihren traditionellen professionellen Partnern beim Überführen eines Autorenmanuskripts hin zu Handel und Lesern.
Das ist einerseits klug, weil Geschlossenheit stärkt. Doch es übertüncht auch, in welch großem Ausmaß die Kräfte des Marktes und der Medien die Autoren seit ein, zwei Jahrzehnten de facto in höchst unterschiedliche Untergruppen auseinander gerissen haben. Und die Interessensgemeinschaft mit den Verlagen enthält von jeher schon einen massiven Konflikt um Konditionen, in dem die meisten Autoren nur eine schwache Position halten.
Erst unlängst legte eine überaus sachliche Studie für englische Autoren dar, dass deren durchschnittliche Einkommen aus dem Schreiben seit Jahren kontinuierlich sinken. Auch deutsche Verlage wissen zu erzählen, wie bei Belletristik und Sachbuch die Durchschnittsauflagen drastisch zurückgehen. Da Jahr für Jahr mehr neue Titel erscheinen und der Buchmarkt insgesamt tendenziell schrumpft, kann dies auch gar nicht anders sein.
Wenn dann auch noch eine sehr kleine Zahl von Spitzentiteln in immer luftigere Verkaufshöhen schnellt, und nun auch über Selbstverleger-Bestseller ganze Genres sich auskoppeln, dann ist für Autoren Feuer am Dach. Der Kuchen, der im Kernbereich des Lesebetriebs abgesetzt werden kann, wird von allen Seiten her angenagt.
Dass in den aktuellen Konflikten nicht alle Autoren gleich sind, hat sogleich ein eigener Brief amerikanischer Selfpublishing-Autoren um Hugh Howey gezeigt, in dem Amazon gegenüber den Konzernverlagen wegen dessen Selfpublishing-Angeboten als Ausweg und neue Perspektive gelobt wird. Hugh Howey hatte zuvor schon mehrere Author-Earnings-Reports veröffentlicht, in denen er argumentiert, dass Autoren im Selbstverlag durch höhere Auflagen aufgrund niedriger Preise von nur ein paar Dollar pro Buch letztlich besser abschneiden. Diese Analysen sind jedoch methodisch umstritten, weil sie fast einzig auf Amazon-Rankings aufbauen, deren mathematische Grundlage jedoch als ein strenges Betriebsgeheimnis gehütet wird.
Interessanterweise lehnt sich dem gegenüber der Anti-Amazon-Brief deutscher Autoren sehr viel weiter aus dem Fenster mit der Behauptung: „Amazon manipuliert Empfehlungslisten.“ Ein klarer Beleg dafür fehlt jedoch in dem Schreiben.
Ich beobachte diese Empfehlungen auf Amazons Webplattform selbst seit ein paar Jahren einigermaßen systematisch, wenn auch nur in punktuellen Ausschnitten. Über Einzelfälle, beispielsweise für ausgewählte Bücher im Konditionenstreit mit Hachette USA oder Bonnier Deutschland, die etwa aus den Empfehlungslisten („…hat auch gekauft…“) ausgeklammert würden, vermag ich nichts auszusagen. Das Gesamtbild, das sich an von Detaildaten auf den Onlineseiten in Form einer Trendbeobachtung mitlesen lässt, erscheint mir indessen als insgesamt einigermaßen konsistent.
Der Club der Alten, und die Amazon-Provokation
Der traditionelle Buchmarkt, mit seinen vielfältigen persönlichen Verwobenheiten zwischen Autoren, Lektoren und Medien, seinen Familienbetrieben bei Verlagen und Buchhandel, den Rivalitäten und Querelen – um gar nicht erst einzutauchen in die noch obskurere Sphäre der literarischen Agenten (!) – verstand sich von jeher als ein weitgehend geschlossener Club, der neue Mitglieder, auf allen Ebenen, nur vorbehaltlich komplizierter Initiationsriten zuließ. Davon zeugt nicht zuletzt eine reichhaltige wie pittoreske Literatur von Autor-Verleger-Korrespondenzen seit mehr als zwei Jahrhunderten, vielfältigen professionellen wie auch erotischen Beziehungsgeflechten, und in Folge unterschiedlichsten wie auch unentwirrbaren Verbandelungen.
Amazon hat von Anfang an, mal mehr, mal weniger, deutlich gemacht, an diesen Wirrungen wenig Interesse zu haben. Herr Bezos ist ein gelernter Investmentbanker und, soweit bekannt, kein Geheimbündler. Allerdings, wenn es um die Außenkommunikation geht, dann ist Amazon so schweigsam und abgeschottet wie ein schottisches Schloss im Hochmoor.
Im Folgeschritt, für den Amazon nun schon seit etlichen Jahren Schwung aufnimmt, will der Online-Händler aus Seattle (der auch aufgrund seiner Herkunft so gar nicht geprägt ist von der europäisch anmutenden Kultur der nordamerikanischen Ostküste, von New York oder Harvard/Neuengland/Boston) all die alten Akteure gleichsam in Bausch und Bogen ersetzen durch seine eigenen, allein am „Consumer“ orientierten Angebote und Strukturen. Zu Amazons Firmenkultur gehört, dass bei wichtigen Sitzungen jeweils ein Stuhl unbesetzt bleibt – stellvertretend für diesen so zumindest gedanklich anwesenden Konsumenten.
Diese Strategie der Neuerfindung und des Ersetzens inkludiert selbst die Autoren. Schon vor Jahren investierte Amazon durch Übernahmen und eigene Entwicklungen in Print-on-Demand Firmen wie in User Communities („Good Read“), und startete den Ebook-Markt 2007 de facto im Alleingang mit dem Launch des Kindle und der entsprechenden Vertriebsplattform auf seinen Webshops.
Es zählt zu den Meisterstücken in Amazons Mix aus Innovation, Beharrlichkeit wie auch sturer Machtstrategie, dass es dem Kindle-Team damals gelang, die sechs führenden US Verlage davon zu überzeugen, ihre wichtigsten Neuerscheinungen in digitalen Ausgaben in das riskante Projekt einzubringen.
Den wirklichen Durchbruch erlebten Ebooks in den USA zu Weihnachten 2010. Das ist gerade einmal vier Jahre her. Heute machen digitale Ausgaben rund ein Viertel der Umsätze in den großen Publikumsverlagen aus.
In Deutschland hat dieser Durchbruch 2012 eingesetzt, vor zwei Jahren.
Vernünftigerweise ist indessen von einer Umbruchsphase von wenigstens zwei Jahrzehnten auszugehen, bis sich die neuen Modelle und Konsumgewohnheiten mehrheitlich durchgesetzt haben werden – wie auch immer diese sich gestalten, denn dies ist eine nach vorne hin noch weithin offene Reise!
Teil 2: Der Aufschrei der Autoren
In der Anzeige der amerikanischen Autoren in der New York Times wird Amazon – in Kombination mit den Leistungen der Autoren – durchaus Respekt gezollt als einem Start-Up Unternehmen, das sich zu einem Weltkonzern gemausert hat, nicht zuletzt dank der Leistungen der Autoren:
„We have made Amazon many millions of dollars (…)“, und natürlich haben darüber auch die Autoren selbst gut verdient. Nun aber blockiere Amazon die genuinen Rechte dieser Autoren in seinem Konditionenstreit mit Hachette, indem es deren Bücher zurückhalte. „This is no way to treat a business partner.“
Der eingangs sehr ähnliche deutsche Protesttext der Autoren wird dann aber spezifisch europäisch abgewandelt, indem er auf die Umstände von Vielfalt und kultureller wie auch moralischer Wertigkeit eingeht: „Wir wollen im Streit zwischen Amazon und Bonnier nicht Partei ergreifen, sondern wir fordern Amazon entschieden auf, nicht länger Bücher und damit auch Autoren und Autorinnen als Geiseln zu nehmen, sondern eine lebendige, ehrliche Buchkultur zu gewährleisten und die benannten Maßnahmen zu stoppen.“
Hier wird jedoch von den deutschen Autoren eine Brücke geschlagen, für deren eines Ende – seitens Amazon – es kein wirkliches Auflager gibt. Denn Amazon hat niemals behauptet, ein Teil dieser herkömmlichen Buchkultur sein zu wollen.
Doch auch die großen, innerhalb der letzten anderthalb Jahrzehnte gewachsenen globalen Konzernverlage fügen sich nur mit Ächzen und Drücken ins romantische Bild der ehrwürdigen Buchmanufakturen aus dem Geist des 19 Jahrhunderts ein.
Das mag man diesen Konzernen nicht einmal vorwerfen. Denn die Herausforderung heute besteht nun einmal darin, Autoren-Inhalte im weltweiten Maßstab zu produzieren und zu vertreiben. Mit zwei Milliarden Euro Umsatz ist der französische Buchkonzern Hachette Livre, an dem sich der Streit erst einmal entzündet hatte, recht groß. Der gesamte deutsche Buchmarkt hat ein Volumen von 9 Milliarden Euro. Amazon jedoch wiegt mit über 55 Milliarden Euro Umsatz ein Vielfaches von Hachette, und versucht nun diese Fallhöhe zu seinem Vorteil zu nutzen.
Ein kurzer, wenngleich wichtiger Einschub, die Größenverhältnisse betreffend, ist hier angebracht: Mancherorts blitzen nun Vermutungen auf, Amazon verhalte sich gegenüber den Buchkonzernen nur deshalb so grob, weil es bei hohem Umsatzwachstum, jedoch bestenfalls marginalen Gewinnen und zuletzt sogar erheblichen Konzernverlusten, ob der sich enttäuscht abwendenden Buchkäufer seine Felle davonschwimmen sehe. Das ist Unsinn, allein schon aufgrund der Dimensionen. Die großen Investitionen, die in den Bilanzverlusten zu Buche schlagen, sind etwa Amazons kürzlich angekündigte 2 Milliarden Dollar schwere Investition in Indien, und wohl ähnliche Summen, die für China reserviert sind, bei denen es um weit mehr als um Anstöße für die Unternehmenssparte Buch- und Medienhandel in den jeweiligen Märkten geht.
Ein Spielfeld mit gewaltigen Unterschieden und Konfliktpotenzial – auf allen Ebenen
Die verschiedenen losen Enden meiner – sehr unvollständigen – Betrachtungen lassen sich in einer Feststellung zusammenführen:
Was die Entwicklung auf allen Ebenen- Autoren, Verlagen, Vertriebsplattformen, aber auch lesenden Konsumenten – am stärksten charakterisiert ist ein massives Auseinanderdriften von Groß und Klein, Erfolgreichen und Nischenbewohnern, zulasten der ehemals stabilen Mitte.
Amazon, Konzernverlage wie Hachette oder Bonnier, und konzernunabhängige Verlage wie Hanser, Aufbau oder Suhrkamp spielen ein jeweils weitgehend unterschiedliches Spiel. Berührungspunkte und direkte Konkurrenzen ergeben sich allenfalls punktuell, wenn auch die mittelgroßen, konzernunabhängigen Verlage um wenige erhoffte Bestseller mitbieten müssen, zur Profilierung von Programm und Bilanz. Ein Glücksgriff oder ein grober Fehler in diesen Spielen entscheidet bei den Konzernen über Glück oder Verlust in einer Jahresbilanz. Bei den Mittelgroßen geht es um den Fortbestand. Im schlimmsten Fall wird das Unternehmen zum billigen Übernahmekandidaten für die Konzerne.
Selbst überaus erfolgreiche Schriftsteller, ganz willkürlich herausgepickt etwa Daniel Kehlmann oder Uwe Tellkamp, stehen auf der gegenüberliegenden Seite des Grabens, und haben wenig gemeinsam mit den Erfolgsdimensionen eines Dan Brown, Stieg Larsson oder von „Fifty Shades of Grey“. Bei den selbstverlegten Autoren sind diese Diskrepanzen noch einmal mit einem Faktor von wenigstens 100 zu multiplizieren.
Paradoxerweise sind genau deshalb die bislang zwei vielstimmigen Weckrufe von (herkömmlichen) Autoren in den USA und in Deutschland so schlagend und wichtig – weil sich hier ein breites Spektrum höchst unterschiedlicher Autoren (ein letztes Mal?) zusammenfindet in einem Bündnis für die sich auflösende, fragmentierende, alte Welt von Schriftstellerei, Buch und Lesen.
Ihre erstaunliche Mobilisierungskraft wird freilich nicht direkt und allein auf sich gestellt die erhofften Wirkungstreffer bringen, um die Giganten – Amazon, aber auch die Verlagskonzerne – zur Räson zu bringen, etwa über Hebel wie Konsumentenprotest, Buy-Local-Bewegung oder dergleichen. Es geht vielmehr um stärkere, wenngleich indirekt verlaufende Kraftlinien.
Die Räson, von der ich hier rede, ist, im besten Falle eine andere, und kompliziertere. Es geht letztlich nicht um eine primär moralische Dimension, sondern um den Fortbestand einer Balance, einer Vielfalt, in der ganz unterschiedliche Akteure, Gewichte und Ambitionen ihr Auskommen finden.
Kurzum, beim Streit zwischen Amazon, den (Konzern-)Verlagen und nun auch den Autoren geht es tatsächlich um eine fundamentale Weichenstellung, wie künftig Bücher geschrieben, vertrieben und gelesen werden (und entsprechendes gilt sinngemäß auch für andere kulturelle Inhalte), und wer auf diesen Feldern die Spielregeln kontrolliert.
Dass sich dabei eine der Streitparteien, nämlich Amazon, anmaßt, allein die Interessen der größten und vielfältigsten aller betroffenen Gruppen zu vertreten, nämlich die Konsumenten, also die Lesenden, wirft ein grelles Schlaglicht darauf, wie bizarr verzerrt die Betrachtungen und Blickwinkel auf das Geschehen derzeit noch sind.
Doch plötzlich ist das Gerangel in der Mitte der Aufmerksamkeit angelangt, als eine gesellschaftspolitische Debatte über die Ökonomie der neuen digitalen Kulturen. Das war überfällig.
Für eine soziale Marktwirtschaft im Buch Business: 3 Schwerpunkte
Das Ziel dieser Debatte muss sein, Räume zu öffnen, in denen die von den deutschen Autoren angerufene Fairness und Vielfalt, also das Mit- und Nebeneinander sehr unterschiedlicher Akteure, Gestaltungen und Zielsetzungen in Sachen Buch und kultureller Inhalte generell sich entwickeln und nachhaltig fortbestehen können.
Doch müssen diese Räume auch attraktiv für Innovatoren sein, die neu denken und neu definieren, wie im digitalen Kosmos zu schreiben und zu lesen und zu vermitteln sei. Dies umfasst die gesamte Skala von experimentellen beziehungsweise nicht-kommerziellen, Vorhaben bis zu kommerziellen, lokalen wie auch globalen, kulturindustriellen Ansätzen.
Viel einfacher als solch eine Utopie abstrakt zu skizzieren ist es für mich, hier exemplarisch drei Schritte zu benennen, die dort hin führen.
1. Erstens gilt es, faire wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen.
Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist auch bereits gesetzt, wenn ab 2015 Amazon und andere globale Konzerne unter dem Wortungetüm „Bestimmungslandprinzip“ dort ihre Umsatzsteuer abführen müssen, wo sie ihre Umsätze generieren (mehr hier).
Damit gibt es für sie in einem exemplarischen Punkt keinen Vorteil mehr gegenüber dem Buchhändler an der Ecke, und mit der neuen Steuerregel wird auch (hoffentlich) ein sehr grundsätzliches Zeichen in Richtung wirtschaftlicher Ausgewogenheit und Rationalität gesetzt.
2. Zweitens müssen die rechtlichen Umgangsformen mit den digitalen Inhalten zeitgemäß angepasst werden. Stichwort Urheberrecht und Einführung eines „Fair Use“-Prinzips.
Dagegen wehren sich Verlage wie auch Autoren nach Kräften. Aber am Ende kann der laute Lobbyisten-Schuss nur nach hinten losgehen, wenn die Produktionsseite auf Regeln beharrt, die einer vergangenen materiellen Welt und Vorstellung vom Kulturkonsum entstammt.
„Fair Use“ bedeutet die angemessene Erweiterung einer beschränkten, nichtkommerziellen Nutzung von Inhalten in den digitalen Räumen – und deren pauschale Abgeltung zugunsten der Urheber. Dieser Wandel braucht allerdings auch eine Verteilung der Abgeltung für diesen Konsum durch präzise wie umsichtig definierte Abgaben, und eine transparente Verteilung dieser Gelder nach einem Schlüssel, welcher nicht – so wie bislang – die wenigen Spitzenverdiener bei Büchern, Musik oder Film noch weiter privilegiert, sondern Vielfalt, Innovation und junge Talente unterstützt.
3. Drittens braucht es eine breitere Unterstützung – finanziell wie auch symbolisch – der nicht-kommerziellen kulturellen Domänen.
Wir dürfen uns nichts vormachen: Es gibt – ähnlich wie im Sozialen – in zunehmendem Maße Bereiche im Schaffen und Vermitteln kultureller Inhalte, die sich längst nicht mehr über den Markt finanzieren lassen. Einnahmen aus Buchverkäufen erlauben nur wenigen Autoren, und noch weniger Übersetzern, ihren Unterhalt daraus zu bestreiten. Kulturelle Bildung und kulturelle Zugänge auf breiter Ebene zu organisieren ist ebenfalls eine gemeinschaftliche Aufgabe, und nicht primär eine Nische auf einem wie auch immer gearteten „Markt“. Die Aufzählung lässt sich erweitern.
Dabei geht es nicht nur um direkte finanzielle Förderungen, sondern ebenso um Ermutigungen, solchen Aktivitäten öffentlichen Raum und Aufmerksamkeit zu widmen, bei Kommunen, Ländern, auf Bundesebene, gesamteuropäisch, in öffentlich-rechtlichen Medien, wie auch durch Anreize für private Akteure, diese zentralen kulturellen Anliegen zu den ihren zu machen.
Es ist nur scheinbar ein Paradox: Die große Globalisierung, die Amazons Expansion zum Weltkonzern erst ermöglicht hat, ruft geradezu gesetzmäßig vielfältige Lokalisierungen in den unterschiedlichsten Spielarten und Größenordnungen ins Leben.
Die digitale Vernetzung – das wird aktuell durch die Schatten der Enthüllungen digitaler Bespitzelungen ein wenig aus dem Blick gedrängt – ist ein mächtiges Instrument der Zivilgesellschaft, gerade auch wenn es um die Produktion und Nutzung kultureller Inhalte geht.
Solche Agenden erscheinen mir dringlicher, und auch realistischer zu sein, als auf eine Zerschlagung von Amazon, Google oder anderer Konzerne durch wen auch immer zu setzen.
Zugespitzt formuliert:
Es gibt Strategien und Handlungsansätze für den Übergang zu einer ausbalancierten Ökonomie der neuen digitalen Kulturen. Sie sollten jedoch aus einer mündigen Bürgergesellschaft kommen. Falsch ist die Hoffnung auf den Staat als Deus Ex Machina.
Rüdiger Wischenbart ist Journalist, Buchmarkt-Analyst und Unternehmensberater.
Zuerst veröffentlicht bei perlentaucher.de, danke für die Zustimmung zur Zweitveröffentlichung











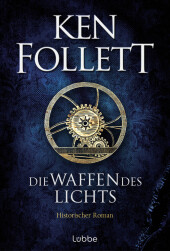
Kommentar hinterlassen zu "Rüdiger Wischenbart: Die Buchkultur und der leere Stuhl"