Stephan Porombka ist seit September 2012 auf Twitter. Als Professor der Berliner Universität der Künste ist er beschäftigt mit Fragen der Texttheorie und Textgestaltung. Für das Buch „Über 140 Zeichen“ (Frohmann Verlag) gibt er einen Einblick in seine Twitter-Praxis.
1.
Ich fange mit etwas Kleinem an.
Es ist morgens, acht Uhr. Die Septembersonne scheint durch die beiden Fenster in eins der großen Zimmer und noch weiter bis tief in die Küche hinein. Dort steht am langen Tisch ein Stuhl, von dem der Sitz und die Rückenlehne zu einem feinen Netz geflochten sind.
Die Sonne steht so, dass sie durch die Lehne scheint und helles Licht und schwarze Schattenlinien auf die Tischplatte wirft, als würde sie, etwas verzerrt, das Netz auf das Holz kopieren.
Genau an dieser Stelle liegen ein paar Sachen, die dort eher zufällig gelandet sind. Es sind Blätter, Unterlagen, zusammengeschoben zu einem etwas unordentlichen kleinen Stapel. Daneben ein Buch, das ich am Tag zuvor per Post bekommen habe.
Es ist ein Buch über den Philosophen Walter Benjamin. Auf dem Cover ist sein Kopf von der Seite zu sehen, es scheint, als würde er tagträumend ganz bei sich sein und zugleich weit nach vorne schauen.
Benjamin hat vor knapp hundert Jahren einen besonderen Blick für die moderne Welt entwickelt. Er hat sie in Puzzlestücken aufgesammelt, um etwas Besonderes an ihnen abzulesen: ihren Zusammenhang mit dem Großen und Ganzen der Gegenwart und der nächsten Zukunft. Das hat er gemacht beim Lesen von Büchern und Zeitungen, in Gesprächen, auf langen intensiven Spaziergängen, bei Besuchen in Bibliotheken und Archiven, wo ihm nichts zu klein und zu flüchtig war, um es nicht genauer anzuschauen, durchzulesen und aufzuheben. „Ich werde keine geistvollen Formulierungen mir aneignen, nichts Wertvolles entwenden“, hat er gesagt. „Aber die Lumpen, den Abfall: die will ich nicht beschreiben, sondern vorzeigen.“ Ich habe es gestern beim Durchblättern gelesen und angestrichen.
Neben Benjamin liegt ein Memory-Spiel. Es besteht aus Kärtchen, die Ausschnitte der Zeichnungen vom Designer Charley Harper zeigen. Es sind Bilder von Vögeln, Insekten, Pflanzen, Landschaften, die Harper vor einem halben Jahrhundert mit klaren Strichen und Flächen so eigenartig stilisiert hat, dass man sie sich mit dem Auge erst neu zusammensetzen muss. Für Memory-Spieler ist das eine echte Herausforderung.
Ich bin auf dem Weg in die Küche, weil ich den Tee aufgießen will, so komme ich genau an dieser Stelle vom Tisch vorbei und diese Berührung zum Leuchten bringt.
Für einen Moment sieht es so aus: Benjamin steht hinter einer Gardine und beobachtet die Vögel im Garten. Dabei wirkt der Schatten, den die Sonne von draußen durch meine Fenster bis auf das Buch und das Memory wirft, wie sphärische Energie. Sie verbindet den Kopf und den Blick des Philosophen mit Harpers kleinen Bildern.

Das ist so überraschend schön und, was Benjamin betrifft, so richtig, dass ich das heiße Wasser in die Teekanne gieße, dann die paar Schritte zurückgehe zum Tisch und nach meinem Smartphone greife.
Ich öffne auf dem kleinen Bildschirm eine App und klicke auf Kamera.
Ich gehe etwas näher an die Tischplatte heran, rücke wieder weg, probiere verschiedene Winkel, entscheide mich dann für den frontalen Blick von oben und mache ein Bild.
Der Boden, der Stuhl, der Tisch, das Buch, das Memory; durch das Licht von hinten wirkt es auf dem Display so, als hätten sich die Dinge noch einmal verwandelt. Sie schweben flach und tief zugleich zwischen zwei und drei Dimensionen. Ich mag dieses Schweben. Ich will noch mehr davon, also öffne ich die nächste App, um mit ihr über das Bild einen Filter zu legen, der das Schweben durch Kontraste verstärkt.
Dann sichere ich die Datei in meinem Fotoordner. Fertig ist das kleine Stück, mit dem ich den Morgen begonnen habe.
Inzwischen ist nicht mal eine Minute vergangen.
2.
Ich mag das sehr, denke ich, lehne mich an den Küchenschrank, schaue auf den Tisch, auf dem die Sonne sich mit ihren Schatten weiter bewegt, bis sie Buch und Memory loslässt und sich dann aufmacht, ganz aus der Küche verschwindet.
Dabei schaue ich auf das Display vom Telefon und öffne die nächste App.
Sie verbindet mich mit einer Adresse im Netz. Instagram. Dort kann ich Fotos speichern, die ich mit meinem Smartphone mache.
Fotos speichern heißt auf dieser Seite immer auch: Fotos teilen. Was ich hochlade, können alle sehen, die sich mit derselben App angemeldet und sich mit mir über einen Klick verbunden haben.
Sie folgen mir. Ein paar von ihnen kenne ich, die meisten aber kenne ich nicht. Ich folge nicht allen von ihnen. Dafür folge ich anderen, die nun wiederum mich noch nie gesehen und meinen Namen vielleicht nur flüchtig wahrgenommen haben.
Es sind nicht mal zwei Minuten vergangen, seit ich die Idee hatte, das Bild von Benjamin und dem Memory im Sonnenlicht zu machen. Jetzt erscheint es an der Spitze der vielen hundert Fotos, die ich hier in den letzten Monaten hochgeladen habe und die einfach chronologisch angezeigt werden. Immer das Neueste ganz oben. Zugleich erscheint es bei allen Leuten, die mir folgen, auf ihrem Bildschirm, wenn sie die Timeline öffnen. Dort werden die Bilder aller anderen User, die man abonniert hat, zu einem Album zusammengeführt.
Vielleicht gibt es ein paar Leute, die das Senden meiner Fotos etwas aufmerksamer verfolgen. Sie werden auf diesem neuen Bild den Stuhl wiedererkennen, den Tisch, vielleicht auch das Memory-Spiel. Es gibt einige andere Bilder von meiner Wohnung, in denen das alles aus verschiedenen Perspektiven schon einmal vorgekommen ist. Vielleicht könnte man, ginge man jetzt das gesamte Album durch, aus all den Bildern meine gesamte Wohnung rekonstruieren.
Da ist der Schreibtisch, da sind die Bücherregale, immer wieder einzelne Bücher, viel Spielzeug ist dabei, Stifte, Papiere, Zeitungen, Hefte, Bastelzeug. Es gibt Bilder vom Arbeitszimmer, vom Wohnzimmer, der Küche, die früher ein großes Berliner Zimmer war, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur und Bad, Balkon, der Blick von dort in den Himmel und auf die Straße. Vor allem gibt es viele Details. Farbreste auf dem Arbeitstisch.
Luftschlangen, die noch von der Feier an der Klinke hängen. Papierblumen. Karten. Die Stahlbänder, aus denen meine Ringe gemacht sind. Kaffeetassen. Klebebilder.
Fast könnte es so wirken, als wollte ich den Stand der Dinge dokumentieren und inventarisieren. Doch bleiben sie nicht so, wie und wo sie sind. Auch das lässt sich über die Zeit in meinem Album verfolgen. Alles ist in einer zarten Bewegung. Einiges verschwindet aus dem Blickfeld. Immer kommt etwas Neues dazu.
Diesmal ist es dieses Buch über den Philosophen Benjamin, das gestern mit der Post gekommen ist. Und diesmal ist es das Memory, das seinen Ort gewechselt hat und plötzlich auf dem Küchentisch liegt, ausgerechnet dort, wo um diese Jahreszeit morgens die Sonne durch die Stuhllehne scheint.
Ich bekomme die Nachricht auf dem Handy, dass mein Bild zwei Leuten gefällt. Ein paar Sekunden später sind es vier.
A. ist Schriftstellerin, die ich flüchtig kenne.
S. hat bei mir studiert und wir sind über unsere Bilder in Kontakt geblieben.
Ay. ist eine junge Frau, ich glaube, sie ist aus Japan. Genaues weiß ich nicht.
B. ist ein Fotograf, der in Berlin unterwegs ist und unglaublich gute Snapshots macht.
Manchmal sind es zehn, fünfzehn Bilder pro Tag, als wäre er ein ruheloser Profifotograf, der im Auftrag der Stadt unterwegs ist. Dabei verdient er mit dem Hochladen und dem Zeigen hier nicht einen Cent. Er zeigt sich nur. Zum Beispiel mir.
Unter meinem Bild erscheint auf dem Display ein kleines Feld, auf dem drei Punkte zu sehen sind. Drücke ich drauf, dann habe ich die Möglichkeit, das Bild noch einmal weiterzuschicken und auf anderen Seiten zu zeigen.
Ich klicke auf teilen.
Dann klicke ich auf Twitter und schreibe auf der Minitastatur vom Smartphone rechts in das freie kleine Kästchen die Worte
Benjamin, morgens, beim Beobachten der Amseln.
Dahinter schreibe ich: @guenterhack
Mit einem weiteren Klick mache ich das, was man Twittern nennt.
3.
Es ist meine 2885. Nachricht. Sie wird in ein, zwei Sekunden gleich dreifach erscheinen. Erstens auf der Timeline von allen anderen, die meine Mitteilungen abonniert haben. Zweitens auf meiner eigenen Seite. Und drittens extra auf einer Seite, die nur Günter Hack sehen kann und auf der für ihn alle Aktivitäten gelistet werden, die etwas mit ihm zu tun haben.
Es sind keine drei Minuten vergangen, seit ich das Bild gemacht habe. Jetzt sieht es Günter Hack.
Ich kenne ihn nur, weil ich ihn bei Twitter abonniert habe. Er sendet hier für 1.200 Leute manchmal fünf, manchmal fünfzehn Nachrichten pro Tag. Es sind pointierte, witzige, sarkastische Sachen, mit denen er den Einsatz von neuesten Medien und die Veränderung der Lebens- und Arbeitsweisen kommentiert.
Hin und wieder sendet er auch einen Link zu seinem Blog, auf dem er längere Texte publiziert. Eigentlich betreut er für das Fernsehen einen Online-Auftritt. Er hat auch einen Roman veröffentlicht, in dem er davon erzählt, wie die Programme der Computer die Lenkung der Welt übernommen haben.
Und dann gibt es eben noch Twitter. Und hin und wieder gibt es hier zwischen all dem Sarkasmus eine zarte Nachricht über die Amseln, die Hack von seinem Fenster aus sehen kann. Monsieur und Madame Amsel, beide mit Schneeflocken auf dem Gefieder, zum Frühstück.
Das kann man eigenartig finden, aber so ist es: Hack gehört mit seinen Amseln und all den andern kleinen Texten zu meinem Leben. Er weiß das nicht, aber er ist der Ornithologe für mich, der kleine Beobachtungen von dem versendet, was draußen im Garten und auf dem Bildschirm des Computers passiert.
Weil das so ist, widme ich ihm das Benjamin-Bild mit dem Memoryspiel. Deshalb füge ich seinen Namen an meinen Text, an dem das Bild hängt, und sende es ihm als kleines Geschenk.
So sind dann keine vier Minuten vergangen, der Tee hat gezogen. Dann sehe ich, dass Günter Hack das Geschenk gefällt.
Denn er nimmt es und drückt auf retweet, also er kopiert und schickt es weiter, um es auf seiner Seite und auf seiner Timeline allen Leuten zu zeigen, die ihm folgen.
Dann trinke ich den ersten Tee an diesem Morgen. Es sind fünf Minuten vergangen.
Walter Benjamin ist jetzt mit meinem Memory da draußen unterwegs. Es kommen, wie ich auf dem Display sehen kann, immer noch ein paar Leute dazu, die mein Bild mit ihm mögen und die es selbst retweeten, um es in die nächste Umlaufbahn zu schicken. Das geht die ganze Zeit immer noch ein bisschen weiter so, das Bild dreht Runde um Runde.
Ein paar Minuten später verliere ich es aus dem Auge.
4.
Weil ich Zeit habe, noch ein bisschen in der Küche stehen bleibe und der Sonne beim Verschwinden zuschaue, kann ich darüber nachdenken, warum mich die vergangenen Minuten so sehr euphorisieren.
Das ist nicht so, weil ich glaube, gerade ein Werk geschaffen zu haben, das bleibenden Wert hat. Ich messe den Wert der Minuten auch nicht an den Likes und Sternen, die das Bild auf seinem Weg durch die Umlaufbahnen der Plattformen im Netz bekommen mag. Nicht dass diese Rückmeldungen unwichtig wären. Sie gehören dazu, weil sie Resonanzen sichtbar machen. Aber euphorisch macht mich etwas anderes.
Es ist nicht das Große, sondern das Kleine, das meine Stimmung hebt. Es ist nicht das Werk, sondern die Bewegung. Es ist nicht das Bleiben, sondern das Verändern des Zustands bis hin zum Verschwinden. Dabei ist es das Bewusstsein davon, dass ich mich an einem Ort befinde, an dem ich sein will: mitten in einem Raum, den ich mangels anderer Worte als eine Werkstatt bezeichne, in der ich auf spielerische Weise Sachen ausprobieren kann, die eigentlich zu einem Repertoire gehört, das die Kunst in der Moderne entwickelt hat und seither immer weiter entwickelt.
Es beginnt mit dem Zufall, der die Idee des Schicksals ablöst und lieber mit Wahrscheinlichkeiten, Risiken und den Fragen einer auf die Zukunft hin offenen Gegenwart umgeht. Die Kunst lässt sich, wo sie diese Fragen aufnimmt und ästhetische Experimente durchführt, von dem überraschen, was plötzlich da ist. Sie entdeckt ein Suchen, das noch nicht weiß, was es finden will. Und wenn etwas gefunden wird, versteht sie es als Material, mit dem man arbeiten kann, um es in etwas Neues zu verwandeln.
Das ist dann gleich das Nächste, was zur Kunst gehört und was ich an meinen kleinen morgendlichen Handgriffen wiederfinden kann: die Idee, dass im Zuge dieser Verwandlung das Material nicht verschwindet, sondern sichtbar bleibt. Sehen soll man die Spuren des Eingriffs. Nicht vergessen werden soll, dass jemand zugegriffen und eingegriffen hat, um etwas, das es schon gibt, zu etwas Neuem zu machen.
Kombiniert mit dem Zufall führt das zur Improvisation. Wer improvisiert, weiß vorher nämlich gar nicht, wo es hin geht. Man weiß auch nicht, ob man ankommt. Improvisierendes Bearbeiten kennt den Endzustand nicht. Es setzt ein Spiel in Gang, das ein offenes Ende hat und nicht nur deshalb fasziniert, weil am Ende etwas Gelungenes steht. Es fasziniert bereits in den Momenten des Gelingens.
Im Falle meines kleinen Bildes improvisiere ich mit dem Material in meinem Bild durch Kombination. Es kommen Dinge zueinander, die so gar nicht zusammengehören und die eben nur der Zufall nebeneinander gelegt hat.
Sie berühren sich und gehen durch Schatten und Licht ineinander über. Doch bleiben sie, schaut man nur lang genug hin, sie selbst. Tatsächlich spielen sie irgendwann für den Betrachter zwischen zwei Dimensionen. Sie stellen etwas Drittes her, das weder das eine noch das andere ist. Es ist die Bewegung dazwischen.
Die Kunst ist fasziniert davon, dass diese Bewegung auf spielerische Weise neuen Sinn erzeugt.
Ich kann plötzlich Benjamin sehen, wie er die Vögel betrachtet, die eigentlich nur Kärtchen sind.
Ich kann Benjamin sehen, wie er sich als Sammler von Spielzeugen für das Spiel interessiert.
Ich kann ihn sehen, wie er die Kärtchen wie Dokumente nimmt, die er in Puzzlestücke für ein monumentales Panoramabild eines Jahrhunderts verwandelt.
Wie er am Flug der Vögel, die auf den Kärtchen dargestellt sind, die Bewegung der Träume der Kultur abliest.
Ich kann Benjamin hören, wie er von seiner Arbeit am Passagen-Werk sagt, ihre Methode sei die Montage, „ich habe nichts zu sagen, nur zu zeigen“.
Damit schließen sich für einen kurzen Blick Benjamins Theorien und Methoden der Erforschung der Moderne an das Netz an, das als Schatten über diesem Bild liegt. Und damit kommt etwas von ihrer Energie auch dort an, wo Günter Hack sitzt.
Weil das aber nun alles im Bild selbst gar nicht drin steckt, sondern im Auge des Betrachters überhaupt erst erzeugt wird, hat sich die Kunst seit der Moderne immer weniger für das interessiert, was sie konkret ist, sondern dafür, dass sie etwas erzeugt. Und sie begreift sich deshalb auch als etwas, das gar nicht fertig ist, sondern selbst im Fluss ist. Sie ist ihre eigene Momentaufnahme.
Das geht so weit, dass sie auch ihr eigenes Verschwinden im Blick hat. Statt sich selbst in der Gegenwart festzuhalten, entwirft sie sich auf den nächsten Zustand hin. In dem sie selbst nicht mehr das ist, was sie mal war. Wenn sie ihr eigenes Löschprogramm mit sich führt, dann heißt das unter Umständen auch, dass dieser nächste oder übernächste Zustand heißt: sie ist dann nichts mehr. Sie ist einfach weg. Auf und davon. Der Betrachter verliert sie aus dem Auge. Und die Kunst ist, dieses Verlieren nicht als Verlust, sondern als eine Kunst zu verstehen.
5.
Ich glaube immer noch nicht, dass ich in den Minuten vor meinem ersten Tee etwas Großes geschaffen habe. Aber ich stehe in der Küche, trinke noch eine nächste Tasse, und freue mich daran, mit kleinen Bewegungen größere ästhetische Transformationen in Gang zu setzen und für mich spürbar zu machen. Mehr nicht. Aber auch nicht weniger.
Ich glaube, vor allem deshalb euphorisch, weil es nicht weniger ist.
Diese Bewegungen haben nicht nur unsere Idee von dem verändert, was wir unter einem Kunstwerk verstehen. Verändert haben sie auch das Verständnis von Kreativität.
Früher dachte man, es geht bei der Kunst vorrangig um das große Werk, das am Ende steht. Es muss gut sichtbar sein. Es muss von Dauer sein. Es muss sogar außerhalb der Zeit stehen, um für immer ein exemplarischer Ausdruck von dem zu sein, was der Mensch in seinem höchsten Menschsein leisten kann. Wichtig war nicht, wie der Künstler es macht. Wichtig war, dass der Künstler es gemacht hat.
Wenn ich mit diesem alten Verständnis auf mein Foto von Benjamin und dem Memory schaue, dann sehe ich natürlich nichts. Denn groß ist das Ergebnis nicht. Es ist ja nicht einmal gut sichtbar. Von echter Dauer ist es auch nicht. Es steht deshalb auch nicht außerhalb der Zeit. Es dreht ein paar von seinen Bahnen, und weg ist es. So gesehen bin ich deshalb auch kein echter Künstler. Ich bin aus dieser Perspektive allenfalls jemand, der Kleinkram macht, vielleicht weil er nichts Besseres zu tun hat. Das alte Kreativitätsverständnis kann mir nur eine Aufmerksamkeitsstörung diagnostizieren, vielleicht eine schlichte Internetsucht.
Aber damit halte ich mich nicht auf. Denn mit dem anderen Blick, der sich mit der Kunst der Moderne entwickelt und seither immer weiter entwickelt hat, sind die Zeichen auf Prozess gestellt. Interessant ist, was sich bewegt. Kunst will selbst bewegen. Sie will bewegt sein. Bloß keine Ruhe.
So stark ist dieses Interesse, dass das Gemachte immer unwichtiger geworden ist. Und in den Mittelpunkt ist das Tun gerückt. Frag nicht danach, ob du am Ende ein großes Werk geschaffen hast. Die Frage ist, ob du in Bewegung gewesen bist. Hast Du etwas in Bewegung gesetzt? Und wie bewegt es sich?
Wenn ich meine eigene Wohnung als Werkstatt verstehe, dann heißt das: Für mich ist es ein Ort, an dem ich etwas machen kann. Hier zu wohnen heißt, die Sachen in Bewegung zu halten.
Dazu ist es wichtig, dass hier überhaupt Sachen sind. Wer seine Wohnung als Werkstatt einrichten will, muss Sachen sammeln, von denen nicht ganz klar ist, wozu man sie noch brauchen kann. Es ist ein bisschen, als würde man Werkzeug kaufen, von dem man noch gar nicht weiß, wozu man es benutzen will. Und es ist, als würde man Stoffe kaufen, ohne zu wissen, was man einmal damit machen kann.
Dann ist es wichtig, den Sachen im Raum keinen festen Ort zu geben. Wie sie sich bewegen, lässt sich nach und nach regulieren, nur wichtig ist: dass sie es tun. Die Bücher dürfen nicht so in den Regalen stehen, als stünden sie dort für immer. Eine lockere Ordnung ist gut, um sie wiederzufinden. Eine zu starre Ordnung ist schlecht, weil die Bücher nicht verschwinden und deshalb nicht an anderer Stelle wieder auftauchen können. Bücher müssen sich bewegen lassen, wenn ich sie bewegen will, und sie müssen sich auf geheimnisvolle Weise selbst bewegen können, ohne dass ich etwas dafür tun muss.
6.
Das gilt in meiner Wohnung nicht nur für die Bücher. Denn ich lebe hier mit meiner achtjährigen Tochter. Von ihr kann ich lernen, wie das mit der Bewegung der Sachen funktioniert.
Am Arbeitstisch sitzt sie mir oft gegenüber. Mindestens die Hälfte des Tisches gehört ihr. Auf meiner Seite wird gelesen und geschrieben. Auf der anderen wird gemalt und gebastelt. Manchmal tauschen wir die Plätze. Manchmal bewegen sich die Stifte und Blätter, der Kleber, die Perlen, die Sticker und die Legostücke zu mir rüber. Dann schiebe ich sie zurück oder nach links und rechts. Oder ich behalte sie hier drüben bei mir und lege sie mir hin wie Teile für ein Puzzle, das ich noch nicht kenne. So wird mein Platz zu einer Insel, um die herum immer andere Sachen liegen.
Manchmal schaue ich dem Mädchen zu und sehe, wie sie die Dinge trennt und wieder zueinander bringt. Und manchmal mache ich mit. Wir hören Geschichten, Musik, wir nehmen Gespräche zwischen uns auf. Ich halte fest, was sie sagt, wenn sie über die Dinge spricht, die sie macht. Mich interessiert das, sage ich zu ihr und: Für mich ist das ein Geschenk, Dir zuzusehen, wenn Du etwas machst.
Ich nehme auch Sachen von ihr, wenn sie gar nicht da ist und zeichne, klebe, meistens kombiniere ich die kleinen Teile mit Büchern und fotografiere es. Eine Tasse Kaffee, eine Muschel, eine kleines Blatt mit Stickern drauf. Teile von Puppen und ein Spiegelhalter aus Messing mit einem Vogelhäuschen vorne drauf. Eine Zeit lang habe ich auf fotografierte Gesichter in Kunstbänden Stücke von Spielzeug gelegt. Ich beschrifte Bilder aus Illustrierten, Ausstellungskatalogen oder schreibe etwas mit einem Ölstift in Bücher hinein, um ihren Sinn zu verdrehen. Das alles fotografiere ich und sende es weiter.
Damit werden auch diese Bilder Teil des Archivs meiner Wohnung, das ich auf der Seite im Netz so eingerichtet habe, dass andere es sehen können. Auch sie bleiben nicht an dem Ort, an dem sie gerade sind. Sie setzen sich in Bewegung und landen an einem fremden Platz. Dass Benjamin das Memoryspiel in der Küche berührt, kommt aus diesem leichten Fluss der Dinge, den vielleicht ich selbst in Bewegung gesetzt habe, vielleicht war es auch das Mädchen. Vielleicht habe ich den Blick dafür von ihr gelernt, vielleicht auch umgekehrt. Es ist nicht mehr so richtig auszumachen, und in der Wohnung, die eine Werkstatt ist, ist diese Frage auch egal.
Schaue ich genau hin, erkenne ich darin auch das Prinzip meines Umgangs mit den Büchern, die sich auf eigenartige Weise in meiner Wohnung bewegen. Ich lese sie nicht systematisch. Wenn ich sie mal systematisch lese, dann aus unsystematischer Absicht. Ich lese, wie früher, mit einem Stift, mit dem ich etwas unterstreiche und Anmerkungen auf den Seiten mache. Ich lese aber längst auch mit meinem Handy als Fotoapparat und Aufnahmegerät. Ich mache Bilder von wichtigen Seiten. Wenn mir etwas Längeres einfällt, dann spreche ich es gleich ein, weil mir das Schreiben zu lange dauert.
So zerlegen sich die Bücher in kleine Stücke. Die tauchen dann an anderen Stellen wieder auf und verbinden sich dort mit anderen Stücken. Das Programm Evernote ist der eigentliche Pool, in dem sich alles trifft und untereinander vernetzt wird. Von dort aus führen die Übertragungswege in Word-Dokumente, in Mails, in kleine Sendungen bei Whats App, dann immer wieder auch bei Facebook und Twitter.
Von dort kommen dann auch neue Sachen wieder rein. Stücke, Zitate, Bilder, Ideen, Entwürfe, dumme Witze und Geistesblitze, alles Mögliche, einiges davon halte ich fest, anderes rauscht gleich vorbei.
Es ist, als säße mir am Tisch nicht nur mein Kind gegenüber, mit dem ich ein rätselhaftes, zauberhaftes Spiel mit Dingen, Worten und Farben spielen kann. Es ist, als säßen noch viele andere um den Tisch herum. Und wir spielen ein Spiel, bei dem jeder in dauernd neuen Runden, deren Anfang und Ende nicht auszumachen ist, Material vor sich hinlegt, dann in die Mitte schiebt, wo es sich mit den Einsätzen aller anderen berührt und nach einem undurchschaubaren Regelwerk an alle neu verteilt, die dann daraus etwas machen, was wieder auf den Tisch gelegt und in die Mitte geschoben wird, von wo aus es sich wieder verteilt.
Zum Beispiel der Benjamin mit seinen Amseln.
7.
Wenn ich in der Küche stehe und darüber nachdenke, was mich an all dem so euphorisiert, dann ist es diese Vorstellung von meinem Arbeitstisch und meiner Wohnung als einer Werkstatt, in der ich mit vielen anderen verbunden bin und die deshalb weit über meinen Tisch und meine Wohnung hinausgeht. Die Werkstatt ist noch viel größer. Ich lese und schreibe weiter, wenn ich nachher auf der Straße bin, in der U-Bahn, im Institut, in der Bibliothek, im Café, an einem anderen Schreibtisch.
Und deshalb ist das alles, was ich lese und schreibe und empfange und sende, noch viel größer, unglaublicher. Und die Sachen, die ich mache, sind zugleich viel kleiner, es sind Miniaturen, sie könnten von mir aus noch viel kleiner sein. Manchmal träume ich von all dem, was wir da tun, in Nanoversionen.
Und so ist alles, was da passiert, für mich noch viel erstaunlicher, noch viel interessanter, noch viel bedenkenswerter, als ich es im ersten Moment zu denken vermag, wenn ich in der Küche stehe und sehe, wie Benjamin mit seinen Amseln dann plötzlich wieder auf meinem Display erscheint, von einem anderen Sender, mit anderen Worten, mit anderen Sternen, die von anderen Lesern schon daran gehängt worden sind. Ich lege mein Smartphone auf den Tisch. Links der Benjamin. In der Mitte das Memory. Und rechts daneben das leuchtende Bild, das nach zwei Minuten verschwindet.
Es ist Zeit, noch einen Tee zu machen, und dann ein bisschen zu arbeiten. Drüben am Schreibtisch sitzt das Mädchen. Die anderen auch. Wir wollen noch spielen.
 Stephan Porombka (Hg.). Über 140 Zeichen. Autoren geben Einblick in ihre Twitterwerkstatt
Stephan Porombka (Hg.). Über 140 Zeichen. Autoren geben Einblick in ihre Twitterwerkstatt
Format: E-Book (ePub, mobi, pdf)
Erscheinungsort: Berlin
Verlag: Frohmann
Erscheinungsdatum: 18.03.2014
Preis: EUR 2,99
ISBN: 978-3-944195-24-7
Auszug aus dem Buch „Über 140 Zeichen“ mit freundlicher Genehmigung des Verlags











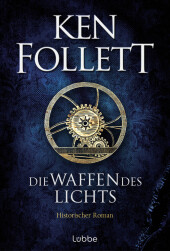
Kommentar hinterlassen zu "@stporombka: Bericht aus der Twitter-Werkstatt"