Wer heutzutage noch die Feuilletons liest, hat oft den Eindruck, dass die Kulturerzieher alles Erdenkliche daran setzen, um bei ihren Lesern eine Bibliophobie zu erzeugen. Unsere leisen Zweifel an der hier waltenden Sachkompetenz sind inzwischen der sicheren Erkenntnis gewichen, dass man Böcke – vor allem aber Ziegen – zu Gärtnern gemacht hat.
Der Text ist eine Zweitveröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Titel Magazins
Die da in gut dotierter und sozial abgesicherter »Kulturmission« schreiben, wissen ganz offensichtlich nicht, was sie tun. Beispiele ästhetischer Fehlleistungen gab es inzwischen zuhauf, man muss kein Querulant sein, um das zu bemängeln. Anzeichen einer Selbstverpflichtung zur Wahrheit sucht man dagegen vergeblich.
In meinem Bekanntenkreis wird ein Verriss in der FAZ oder Süddeutschen grundsätzlich als Empfehlung empfunden. Umgekehrt schreckt man vor den weichspülerischen Fertigteilbausätzen zurück, die nur allzu deutlich auf eine Befriedigung antrainierten Konsumverhaltens abzielen. Man spürt bereits den Zugwind der Bestsellerliste im Nacken. Die wenigsten bemerken noch – wie kürzlich ein ZEIT-Leser – die »fehlende Hilfestellung bei der Auswahl von Literatur«. Das Rühren im Redundanten und Substanzlosen nervt, ganz besonders natürlich die geläufigen Stereotypen: Kann einer nicht schreiben und muss er trotzdem gehypt werden, wird sein »entwaffnend umgangssprachlicher« Ton gelobt. »Ernsthaft« schreibe so einer, »authentisch« und doch »mit großer Leichtigkeit«. Auch dass sich so ein Autor »auf gleicher Augenhöhe mit dem Leser« befände, ist dann von Vorteil.
Der vermeintlich »hohe Ton« eines Schriftstellers, der dem vorherrschenden Kulturrelativismus widerspricht, wird dagegen zerredet oder mit spätstrukturalistischen Aperçus zynisch bewitzelt. Doch geht es beim Schreiben nicht auch um Handwerk, das heißt den kunstvollen Umgang mit Sprache? Die mangelnde Urteilskraft derer, die gewissermaßen den kulturellen Mainstream lenken, tritt hier einmal mehr deutlich zutage. Es ist eine wahre Aprés-Garde, die jetzt kritisiert, und dem Hype in einem geistlosen Labyrinth hinterherhinkt.
Während das 18. Jahrhundert in seinen Feuilletons noch einen »Geistesanbau« sah und denselben pflegte, geht es heute nur mehr um das planmäßige Abfeiern eines »Superstars für 5 Minuten«. Erschreckenderweise steht dieser Etikettenschwindel ganz im Dienste einer ideologisch verseuchten Literaturpolitik. Dem natürlichen Wettbewerb der Anschauungen und Ideen wird durch Denk- und Sprechverbote begegnet. Soziale Ächtung und Karriere-Aus drohen dem, der es trotzdem wagt, seine Meinung zu äußern. So verkommt Kulturkritik zum Bekenntnisreigen, das Schreiben von kulturkritischen Texten zu einer Gebetsmühle von Opportunisten.
Viele der tonangebenden »Kulturkaffern« scheinen zudem dem Zeitgeist verfallen zu sein, der – indem er reale Werte verkennt und die ideelle Falschmünzerei protegiert – in einem ethischen Dilemma verharrt. Sie verhalten sich nicht anders als gewisse Finanz-Manager, die ihren Kunden Junk Bonds und marode Anleihen andrehen. Was momentan geschieht, ist de facto eine kulturelle Obszönität, und somit das exakte Gegenteil dessen, was genuine Kultur ausmachen sollte. Die Vielzahl und Kontinuität der ästhetischen Fehlurteile ist deplorabel. Haben die Feuilletonisten tatsächlich vergessen, dass ihr Einfluss nur geliehen ist, und dass man sie nicht mehr liest, wenn man ihnen misstraut? Und warum sollte man auch Erfüllungsgehilfen des Marktes vertrauen?
Fast wünscht man die Zeiten zurück, in der sich das Feuilleton an ein paar letzte »erleuchtete Seelen« wandte. Die nahmen dieses merkwürdige und undankbare Hobby des Schreibens zumindest ernst. Was sich von den meisten Feuilleton-Schreibern nicht sagen lässt. Dass ihnen übrigens das Gespür für die eigenen Misstöne fehlt, ist unter den vielen unangenehmen Eindrücken, noch die erstaunlichste Feststellung. Ideologische und sprachliche Verabredungen sorgen dafür, dass die Nutznießer unter sich bleiben und dass das »Betriebssystem« – vor allem seine Machtstrukturen – weiter besteht und in Gang gehalten wird. Das funktioniert in etwa wie die Marktwirtschaft, die auch schon lange keine freie mehr ist und in der lauter Versager einander decken.
In der Welt der veröffentlichten Meinung ist es inzwischen nicht anders. Die Posten- und Pöstchenmelange geht Hand in Hand mit tendenziösen oder werblichen Texten. Da lobt beispielsweise Elke Heidenreich den in ihrer Edition erschienenen Hans Neuenfels (Das Bastardbuch) und glaubt ernsthaft, dass niemand den parfümierten Kuhhandel riecht. Nichts gegen Neuenfels, aber was unterscheidet Heidenreichs Rezension von product placement, inklusive PR-Journalismus? Michael Krüger rezensiert die Bücher seines Freundes Wagenbach in der FAZ. Volker Weidermann, Feuilleton-Chef der FAS, adelt seinen Buddy-Boy Maxim Biller zum »besten Stilisten unter den deutschen Schriftstellern« und verschafft ihm eine gut dotierte Anstellung als Kolumnisten. Hubert Burda lobt seinen Schützling Peter Handke, ganz gleich was der schreibt, und Handke verteidigt dafür im Gegenzug die »Super-Illu« seines Mäzens. Alles im feinsten Zwirn auf den Philisterseiten der ZEIT.
Da die völlige Abwesenheit eines beruflichen Ethos der dialektischen Auseinandersetzung mit Literatur nicht unbedingt zuträglich ist, ist es natürlich kein Wunder, dass viele der »tonangebenden Feuilletonisten der Generation Golf« (Deutschlandradio Kultur) ihren Job tatsächlich nur noch als Job verstehen. Ihre meist kurzlebigen Erregungsgemeinschaften dienen als Appetizer für eine bestimmte Produktpalette, die nun mal zufällig aus Büchern besteht. Wir sprechen von Waren, die an den Mann/die Frau gebracht werden müssen. Der »tonangebende Feuilletonist« hilft daher eifrig mit, die Werbetrommel zu rühren.
Man kann der Versuchung kaum widerstehen, hier einmal Tonalitäten mit Markenwelten zu koppeln: Schnellchecker Weidermann alias Hugo (die junge Linie von Boss), seine Schon-bald-Vorgesetzte v. Lovenberg als Ferrero-Schnecke; Dennis Scheck, der freundliche Psychopathetiker von der Raiffeisenbank; Iris Radisch, die vor sich hin menschelnde »Kulturbrauerei« Schultheiss, und Thomas Steinfeld, der etwas aus der Mode gekommene Gedankenfrisör von L’Oreal; Hubert Winkels, der sauerländische Heimwerker von Hornbach und das fleischgewordene Persönlichkeitsschisma Thea Dorn als verkleideter Ricola-Zwerg, der wieder mal für Aufklärung (über Hustenbonbons) sorgt …
Sie scheinen es selbst nicht zu merken, oder? Dabei ist es schon kurios, dass man sich in diesen feinfühligen Kreisen nicht einmal die in Wirtschaft und Politik schon obligatorisch gewordene »Systemfrage« stellt: Sind wir vielleicht alle auf dem richtigen Weg im falschen Dschungel? Verwechseln wir Krampf mit Kunst? Sehen wir vor lauter Sattheit und Selbstgerechtigkeit nicht mehr, worum es geht? Oder wollen wir es nicht sehen? Weil wir sonst in Gefahr laufen würden, unser Pöstchen im Mastdarm des Kulturhegemons zu verlieren? Im Hortus conclusus der Hochliteratur, wo wir uns in der verbalen Jauche einer Charlotte Roche suhlen? In Sampling-Kultur? Augenzwinkernd natürlich – so wie die Literatur-Glucke Auffermann, deren »gefährlich kreatives« Patenkind 2010 als ziemlich dreiste Abschreiberin demaskiert wurde. Da war die Copy-Paste-Bastelarbeit schon zum Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Die politisch korrekte Tränentrine Iris Radisch verglich das aufgeflogene Wunderkind damals übrigens ohne Zögern mit Heiner Müller, und niemand, wirklich niemand, auch kein versprengter, halbverhungerter Bewohner irgendeines Kulturreservats rückte Frau Radisch für diesen Spruch den schwarzgefärbten Fransenpony zurecht! Zeugte der Vergleich mit Müller, immerhin einem der größten Dramaturgen der Neuzeit, nicht geradezu von Verachtung für Literatur? Und von einer schier unglaublichen Inkompetenz?
Im Grunde möchte man die Antwort lieber nicht wissen. Immerhin, nicht alle der obengenannten kamen über eine geschlechtsdemokratische Personalpolitik in ihre medienpolitische Machtposition, und doch haben sie die gleiche Agenda, die eben keine literarische ist.
Was wir momentan als geistigen Sinkflug in die dröhnende Kulturlosigkeit erleben, ist – überspitzt gesagt und in kleinerem Maßstab – das postmoderne Gegenstück zum Faschismus, gegründet auf der Legalisierung des Privilegs, einem Verhaltenskodex der rigorosen Gleichmacherei und der Herrschaft einer subtilen Pornokratie, die erstaunlicherweise ein feministisches Unterfutter aufweist. Im Entwertungsreigen des Spät- oder Feudalkapitalismus ist einfach alles nur noch »Ware« und »Logo«, also auch Feminismus. Den vielen verhaltensauffälligen Frauen, die heute für die Feuilletons schreiben, geht es wahrscheinlich eher um ihren Lifestyle als um Literatur. Man gehört ja zum juste milieu, hat eine Klassengrenze zwischen sich und die brotlosen, wahren Poeten gebracht, und diese Tatsache verdient es, einmal täglich mit einem Prosecco oder Veuve Cliquot am Szene-Tresen begossen zu werden. Und damit das möglichst lange so bleibt, spielt man auch gerne mal den Steigbügelhalter von Charlotte Roche, deren unsäglicher Textbrei das letzte Sommerloch füllte. Nicht das Buch war der Skandal, sondern die Kritik, die sich querbeet durch den Blätterwald nie zu schade war, kunstlosen Quatsch hochzuschreiben. Wahrscheinlich wollte man dem gemeinen Volk den Spaß nicht verderben oder den Absatz der extrem hohen Erstauflage, die jene von Grass, Walser und Frisch übertraf, nicht gefährden. (Vgl. hier: Thor Kunkel über Schoßgebete)
Doch was geschieht mit Büchern, wenn ihr Warencharakter wichtiger wird als ihr Inhalt? Ganz einfach: Die Literatur verliert ihre Glaubwürdigkeit. Literatur war stets der kompromisslose Versuch des Menschen, einen Teil der Wahrheit jenseits aller Gebrauchswahrheiten zu konservieren. Darin liegen die Kostbarkeit des geschriebenen Wortes und der Wert von Literatur. Denn wesentliche Eigenschaften dieser Welt entziehen sich ökonomischer oder logischer Erkenntnis, um sie zu erfassen, bedarf es Seelenarbeit, nicht Kalkül. Vor allem bedarf es keiner Manipulatoren, die geistige Schutthalden, für die sie die Verantwortung tragen, mit ihrem faulen Sermon berieseln!
Ein gutes Beispiel für diese Haltung ist auch die mäßig erfolgreiche Romanautorin Elke Schmitter, die für den SPIEGEL kritisiert. In der aktuellen Ausgabe ist sie mit einem dürftigen Text über Thomas Brasch, Titel: Heldengedenken, vertreten. Offenbar begreift sie nichts von der Tragik dieses an seinen DDR-Übervater gefesselten Menschen, von dem alle wollten, ja, erwarteten, er sei ein Genie. Als »Ulysses von Berlin« wurde Brasch im Westen empfangen, der Suhrkamp-Verlag bot sich ihm ebenso an wie der Theaterfürst Peymann. Brasch hatte aber noch gar nichts Gescheites zustande gebracht! Auch Schmitter will – wie es scheint – an Braschs Legende mitstricken, über den Roman von Klaus Pohl, einem Theaterkollegen von Brasch, möchte sie daher – so wörtlich – »nicht zu harsch urteilen« und schließt dann mit folgendem Schwulst von einem Satz: »Vielleicht müssen noch einmal zehn Jahre vergehen, bis es eine Erinnerung an Thomas Brasch gibt, die auf den Knien des Herzens entsteht, aber nicht auf dem Rücken der Literatur.«
Das Bild »auf Knien des Herzens« stammt aus einem Brief Kleists an Goethe und ist hier schon deshalb völlig daneben. Selten hat man Archivstaub so laut knistern gehört und selten war die Absicht einer Feuilletonistin so offensichtlich, ein lukratives Terrain mithilfe eines Leitmediums zu annektieren. Mit »Kulturpflege« hat das alles herzlich wenig zu tun.
Dass der Fisch vom Kopf her stinkt, vergegenwärtigt niemand besser als die 1974 geborene FAZ-Feuilleton-Chefin von Lovenberg, die laut Eigenwerbung gerade »mit dem wichtigsten Preis für Literaturkritik«, dem Alfred-Kerr-Preis, ausgezeichnet wurde. Es ist nicht leicht herauszufinden, was sie geschrieben hat, um zu solchen Ehren zu kommen. Einmal abgesehen von ihrem bei Droemer verlegten philosophischen Großwerk Verliebe dich oft, verlobe dich selten, heirate nie?. Sollte Hubert Spiegel diese Nachfolgerin selbst bestimmt haben, müsste er sich eigentlich ex post einweisen lassen. Und wie tönern – fragt man sich da – müssen die Füße so einer Karriere eigentlich sein? Wäre so eine »Spitzen-Journalistin« überhaupt in der Lage, einen Roman von Volker Altwasser oder Walter Kappacher zu erfassen? (Dumme Frage, – natürlich nicht, deshalb rezensierte sie ja auch eine Top-Autorin wie Roche. Sie war die erste, die hier Hochliterarisches schmeckte, und wie erlöst von ihren Hemmungen schrieb sie sich – Schoßgebete lospreisend – um Kopf und Kragen.)
Ihre zu einer Media-Watch-Group mutierte Abteilung scheint inzwischen fette Verkaufszahlen mit ideellem Wert gleichzusetzen. Die Spitzenreiter der Bestsellerliste werden nur noch von den besser verdienenden Journalisten besprochen. Doch die haben in den seltensten Fällen literarischen Anspruch, – die Spitzenreiter versteht sich … Es ist der sound der upperclass, für die – wie der Fall Guttenberg wohl hinlänglich bewies – Wettbewerbsverzerrung eine Selbstverständlichkeit ist. Ihre elitäre Haltung begründet sich nicht auf Sachkompetenz, sondern der Tatsache, dass sie drinnen sind und die anderen draußen. Man wird sehen, wie lange sich diese company policy in der FAZ hält. Zu all dem wollte sich Frau von Lovenberg übrigens – auch auf wiederholtes Nachfragen – nicht äußern.
Fazit: Mit ihrem ebenso falschen wie abgekarteten Spiel schädigen die Feuilletons nicht nur den Buchmarkt, sie vernichten auch das noch aus den Tagen der Aufklärung stammende geistige Kapitel dieses Landes und löschen Schriftstellerexistenzen aus, indem sie deren Rezeption verhindern. Stattdessen pushen sie Schrott. Erneut drängen sich ein Vergleiche mit den Schlüsselfiguren der Finanzkrise auf, hier wie da offenbart sich ein ethisches Dilemma, hier wie da verweigert man sich, auf die veränderten gesellschaftlichen Umstände zu reagieren. Das Letzte, was wir heute in den Feuilletons brauchen, ist eine »Stupiditätserzeugungskultur«.
Marx regte in seinen Thesen über Feuerbach an, die (Kultur-)Erzieher notfalls neu zu erziehen. Vielleicht ist es nun an der Zeit.
Die Feuilletons müssen wieder zu einer literarischen Heimat werden, ein buntes, traditionsreiches Viertel in einer profanen Stadt, ein paar verwinkelte Gassen mit Seele, mit Menschen, die wirklich dort leben. Dieser Grad der Vertrautheit schärft die Sinne des Lesers im Hinblick auf Aufmerksamkeit und Genauigkeit der Sprache und der Welt gegenüber. Jede Erweiterung des geistigen Horizonts setzt ein Gefühl von Zugehörigkeit voraus. Wenn es den Feuilletons gleich ist, ob man sie liest oder nicht, wenn sie ihrer »Kulturmission« nicht gerecht werden wollen, dann sollten sie gehen und ihre verkappte Industrietätigkeit besser bezahlt in der echten Industrie fortsetzen. Als Pressesprecherin von Procter & Gamble oder Pfanni wäre Frau von Lovenberg sicherlich gar nicht so schlecht.
Thor Kunkel ist ein deutscher Schriftsteller. Für Aufsehen sorgte er mit seinem Roman „Endstufe“, der im Jahr 2004 eine Debatte in den Feuilletons (hier mehr) auslöste.
 Der Text ist eine Zweitveröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Titel Magazins, des unabhängigen Online-Feuilletons
Der Text ist eine Zweitveröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Titel Magazins, des unabhängigen Online-Feuilletons











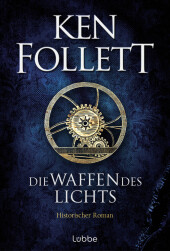
Dann fange wir doch mit der Klärung an, indem wir Adorno-Lesekreise gründen 😉
Gute Frage: Wie konnte es eigentlich zu der grassierenden
Verdummung der deutschen Kulturberichterstattung und der damit
einhergehenden grundlegenden Entwertung von Kultur kommen?
Diese Frage gilt es zu klären. Kunkels Artikel ist ein Anfang.