Lassen Sie uns gleich dort einsteigen, wo es am meisten weh tut – beim Geldbeutel. Die Zeitschriftenkrise ist eines der schmerzhaftesten Symptome der Digitalisierung. Die steigenden Preise für für Zeitschriften-Abos belasten die Etats der Bibliotheken, denen dadurch die nötigen Mittel für die Anschaffung von Monographien und Lehrbüchern fehlen, was wiederum zu Lasten kleinerer Wissenschaftsverlage geht.
 Da scheint es nahe zu liegen, sich über Kosten und deren Verteilung zu streiten. Ich halte diese Diskussion allerdings nicht für zielführend, sondern für im wahrsten Sinne des Wortes existenziell gefährlich, da die Frage nach den Kosten den Blick auf das eigentliche Problem verstellt: die wachsende Abhängigkeit von geschlossenen Plattformen und damit die schrittweise Abschaffung der Bibliotheken – das Aussterben unabhängiger Wissenschaftsverlage inklusive. Von den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen ganz zu schweigen.
Da scheint es nahe zu liegen, sich über Kosten und deren Verteilung zu streiten. Ich halte diese Diskussion allerdings nicht für zielführend, sondern für im wahrsten Sinne des Wortes existenziell gefährlich, da die Frage nach den Kosten den Blick auf das eigentliche Problem verstellt: die wachsende Abhängigkeit von geschlossenen Plattformen und damit die schrittweise Abschaffung der Bibliotheken – das Aussterben unabhängiger Wissenschaftsverlage inklusive. Von den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen ganz zu schweigen.
Um Lösungsansätze für dieses Problem formulieren zu können, müssen wir uns zunächst der Ursachen widmen.
Die Rolle disruptiver Technologien in der Entstehung der modernen Wissens- und Informationsgesellschaft
Mit der Digitalisierung haben wir es nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaftlich mit einem Paradigmenwechsel zu tun, welcher der Erfindung des Buchdrucks in nichts nachsteht.
Gutenberg und die auf ihn folgende industrielle Produktion von Druckerzeugnissen haben sowohl die alte Infrastruktur der Schriftkultur in Gestalt der Klöster mit ihren Skriptorien und Klosterbibliotheken obsolet gemacht als auch die bis dahin tradierten Formen und Gewohnheiten des Lesens und Schreibens radikal verändert.
Texte mussten nicht länger von Hand abgeschrieben werden, um sie zu vervielfältigen – vor allem aber wurden Bücher für andere Gesellschaftsschichten erschwinglich und damit auch außerhalb eines klerikalen oder höfischen Rahmens zugänglich: Druckerzeugnisse fanden Eingang in die bürgerliche Sphäre und wurden zunehmend im privaten Umfeld konsumiert. Der Zugang zu Information und Bildung nicht länger einer gesellschaftlichen Elite vorbehalten, die exklusives Herrschaftswissen hortete.
Verlage, Buchhandel und Bibliotheken übernahmen an Stelle der Klöster die Funktion der Vervielfältigung und Verbreitung von Manuskripten und versorgte statt der herrschenden Klasse nun auch die breite Masse mit Inhalten. Buchhandel und Verlagswesen stiegen dank ihrer Produktions- und Vertriebskapazitäten schnell zur beherrschenden Infrastruktur, zur „Datenautobahn“ der Neuzeit auf. Und selbstverständlich hatte die Säkularisierung der Schrift massive Auswirkungen nicht nur auf die Produktion, sondern auch auf die Rezeption von Texten – bis hin zur Entwicklung unserer heutigen Wissensgesellschaft, die sich nicht zuletzt der erfolgten Demokratisierung von Inhalten verdankt.
Doch die Zeiten des traditionellen Buchhandels und Verlagswesens sind vermutlich unwiderruflich vorbei, ebenso wie die Zeiten klassischer Bibliotheken. Unsere Schriftkultur ist dabei, sich erneut zu transformieren, sich neuer Trägermedien zu bedienen, wodurch die alten Strukturen – zumindest im digitalen Bereich – überflüssig werden. Es ändern sich jedoch nicht nur Strukturen und Technologien, sondern auch die Art und Weise, wie wir Texte nutzen.
Um die weiteren Implikationen zu verstehen, ist es zunächst wichtig, ein Verständnis davon zu entwickeln, was ein „Buch“ ist und wie es in der digitalen Welt „funktioniert“. Das Buch steht dabei exemplarisch für Schrifterzeugnisse, d.h. wir werden bis auf Weiteres nicht zwischen Büchern und Zeitschriften differenzieren und kommen erst später auf die Unterschiede der beiden zu sprechen.
Was also ist ein Buch?
Die Antwort auf diese Frage ist alles andere als offensichtlich, da sie je nach persönlichem Hintergrund, individuellem Kontext und Erwartungen an das Thema variiert. „Das Buch“ kann alles sein, von einem konkreten Werkstück einer Druckproduktion bis hin zu einem abstrakten Symbol, um nicht zu sagen einem Synonym für Kultur schlechthin.
Was aber macht ein Buch zum Buch? Das Papier? Das Material? Die Ausstattung? Letzten Endes ist ein Buch in seiner kodifizierten Form, d.h. in Gestalt eines gebundenen Stapels beschrifteten bzw. bedruckten Papiers, nichts weiter als eine Konservendose, die uns hilft, Sprache zu konservieren, um damit Ideen durch Raum und Zeit, von einem Kopf in den anderen zu transportieren – ganz gleich, ob diese wie auch immer gearteten Ideen primär den Idealen der Aufklärung oder der Unterhaltung dienen.
Das gedruckte Buch besteht damit im Wesentlichen aus zwei Teilen: einem zu transportierenden Inhalt sowie einem Transportmittel bzw. Trägermedium.
Während sich die Frage nach einem geeigneten Transportmittel für Inhalte aller Art in der Vergangenheit relativ pauschal mit „in Form eines gebundenen Stapels bedruckten Papiers“ beantworten ließ, lässt sie sich in der digitalen Welt nicht mehr pauschal beantworten, was letztlich auch an das Selbstverständnis der Verlage rührt.
Ist man noch ein Verlag, wenn man statt Büchern plötzlich Software, Datenbanken, Websites oder Online-Dienste produziert? Und in welchem Markt bzw. in welchen Märkten ist man damit auf einmal tätig, vielleicht ohne dass man sich dessen überhaupt bewusst ist?
Die Antwort auf die Frage, womit man den jeweiligen Inhalt am besten „rüberbringt“, kann also sehr vielschichtig und durchaus auch unterschiedlich ausfallen. Tatsächlich nutzt die Gesellschaft immer mehr Produkte und Dienstleistungen, die sie gar nicht mehr originär als „Buch“ identifiziert, gleichwohl sie ihren Ursprung dort haben.
Erscheinungsformen von Büchern in der digitalen Welt
Prinzipiell lassen sich hinsichtlich der elektronischen Erscheinungsform von Inhalten, die vormals als Druckwerke erschienen sind, vier Segmente unterscheiden, die sich zum Teil auch miteinander kombinieren lassen:
1.) Container-Formate wie PDF oder ePub,
2.) Software-Anwendungen,
3.) Browserbasierte Online-Angebote (also beispielsweise klassische Websites und Online-Datenbanken) sowie
4.) Service-Clouds, die im Gegensatz zu Storage Clouds (wie etwa eine Dropbox oder Open Access Repositories) nicht nur aus einer reinen Verzeichnisstruktur sowie Speicherplatz auf einem Server bestehen, sondern aus einer anwenderseitigen und einer serverseitigen Komponente.
Bei Container-Formaten haben wir es mit Dateien zu tun, die als reine Container Inhalte transportieren. Die darin enthaltenen Inhalte werden, einmal in ihrer inhaltlichen Gestalt fixiert, nicht mehr verändert. Um die in diesen Dateien gespeicherten Inhalte lesbar zu machen, bedarf es weiterer Software und eines geeigneten Endgeräts. Dieses Segment eignet sich in erster Linie für geschlossene Textformen, wie wir sie vor allem in der Belletristik, im Sach- und im Fachbuch finden.
In Software-Anwendungen sind die jeweiligen Inhalte nicht nur in eine Datei, sondern zusätzlich in eine eigene Software (englisch application, oder kurz App) eingebettet, die sich selbst auszuführen imstande ist. Dieses Segment eignet sich für alle jene Bereiche, in denen mit animierten, interaktiven oder anderweitig komplexen Inhalten gearbeitet wird.
Browserbasierte Online-Angebote sind prädestiniert für Inhalte, die in kleineren Einheiten rezipiert werden und/oder einen hohen Aktualitätsgrad erfordern. Gute Beispiele sind die juristischen Datenbanken von C.H. Beck oder Online-Nachschlagewerke wie die „Wörterbücher“ auf www.duden.de, www.pons.eu oder www.leo.org. Konversationslexika wie der Brockhaus haben die Transformation leider nicht geschafft, sodass dieser Bereich heute komplett durch Anbieter wie die Wikipedia ausgefüllt wird.
Bei Service-Clouds haben wir es in der Regel mit einer anwender- sowie einer serverseitigen Komponente zu tun, d. h. eine fest auf dem Endgerät des Kunden installierte Anwendung (App) kommuniziert über eine Online-Verbindung mit einer serverseitigen Anwendung, um dynamisch Daten nachzuladen oder zu synchronisieren.
Die Herausforderung besteht in erster Linie darin, für jede Art von Inhalt das adäquate Transportmittel zu finden, wobei letztendlich lediglich jene Inhalte im ersten Segment der Container-Formate noch eine entfernte Ähnlichkeit mit dem haben, was die UNESCO heute unter einem Buch versteht, also „ein nicht periodisch erscheinendes, der Öffentlichkeit zugänglich gemachtes Druckerzeugnis von mindestens 49 Seiten“.
Wir haben es im Digitalen zwar nicht mehr mit Druckerzeugnissen oder einer festen Einteilung in Seiten zu tun, aber zumindest noch mit einer geschlossenen Textform, sodass wir diese Definition für diese Form des E-Books leicht modifiziert adaptieren können: „eine nicht periodisch erscheinende Veröffentlichung, die sich durch eine geschlossene Textform auszeichnet“. E-Papers könnte man entsprechend als periodisch erscheinende Veröffentlichung definieren, die sich durch eine geschlossene Textform auszeichnen.
Wenn wir also von der Zukunft des Lesens sprechen und darunter die klassische lineare Rezeption von inhaltlich geschlossenen Textinhalten verstehen, soll uns die Tatsache, dass wir es hier mit der „konservativsten“ Form von Texten zu tun haben, nicht darüber hinwegtäuschen, dass in diesem Bereich perspektivisch die größten gesellschaftlichen Veränderungen stattfinden, was sich daran ableiten lässt, wie solche Inhalte verbreitet und genutzt werden.
Elektronische Publikationen sind im Gegensatz zu ihren gedruckten Verwandten keine kompletten, sondern komplexe Produkte
Der Inhalt einer elektronischen Publikation mag zwar identisch mit dem der Druckversion sein, das diesen Inhalt transportierende Produkt besteht in der digitalen Welt jedoch aus unterschiedlichen Komponenten, die grundlegend anderen Regeln und Gesetzen gehorchen als ihre gedruckten Pendants. Auch die Rollenverteilung entlang der Wertschöpfungskette ändert sich zusehends.
Ein Druckerzeugnis ist ein komplettes Produkt, das Inhalt und Ausstattung in sich vereint und ohne weitere Hilfsmittel direkt rezipiert werden kann. Der jeweilige Lesekomfort liegt allein in den Produkteigenschaften der Ausstattung begründet, wozu neben dem Material auch die Gestaltung zählt.
Das Erscheinungsbild bzw. das Nutzungserlebnis des jeweiligen Inhalts liegt damit allein in der Hand des Verlags. Der Wert einer solchen Druckproduktion bemisst sich in erster Linie an ihrem materiellen Tauschwert und unterliegt dem Theorem der Knappheit: je seltener bzw. exklusiver Material, Verarbeitung und/oder Verfügbarkeit, desto wertvoller.
Elektronische Publikationen sind im Gegensatz zu Druckerzeugnissen keine materiellen, sondern immaterielle Güter, die man nicht besitzen und mithin auch nicht erwerben kann. Was der Rezipient erwirbt, ist ein Nutzungsrecht an einem Inhalt, der ihm in Form einer Datei zur Verfügung gestellt wird. Diese Datei allein nutzt dem Rezipienten jedoch herzlich wenig, da er, um diese auch tatsächlich nutzen zu können, noch ein geeignetes Endgerät sowie eine ausführende Software benötigt. Die reine Datei ist also allenfalls ein „halbes“ Produkt, um nicht zu sagen Produktfragment.
Alles, was ein Leser an „Ausstattung“ einer elektronischen Publikation wahrnimmt und erwartet, angefangen von der Möglichkeit, den Inhalt überhaupt erst lesen zu können, über Funktionen, mit deren Hilfe man Textstellen markieren, Notizen oder Lesezeichen erstellen und verwalten kann, bis hin dazu, die auf diese Weise selbst erstellten Inhalte mit anderen Nutzern zu teilen, sind nicht etwa Eigenschaften eines E-Books oder E-Papers, sondern Eigenschaften der ausführenden Software sowie der dahinter liegenden serverseitigen Infrastruktur.
Der Wert einer solchen Publikation für den Nutzer resultiert in erster Linie aus ihrem konkreten Nutzwert, der sich neben dem reinen Inhalt in erster Linie aus den eingeräumten Rechten sowie dem konkreten Funktionsumfang der jeweiligen Softwareumgebung bemisst.
Die verwendeten Geräte spielen dabei im Grunde eine völlig untergeordnete Rolle. Das Entscheidende aus Sicht des Kunden ist, dass, egal, welches Gerät er benutzt, seine Inhalte darauf lauffähig sind. Welche Art von Gerät dann tatsächlich zum Einsatz kommt, hängt maßgeblich vom eigenen Nutzungsverhalten ab: Die Einen bevorzugen dezidierte E-Book-Reader mit einem lesefreundlichen eInk-Display, die Anderen nutzen ausschließlich mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets, weil Lesen lediglich ein Teil ihres Medienkonsums ist.
Im Grunde sind dies alles Varianten des gleichen Prinzips: Man nutzt flache, portable Mini-Computer, die direkt über einen Bildschirm bedient werden und sich allein hinsichtlich ihres Leistungsspektrums sowie ihrer Bildschirmtechnologie unterscheiden.
Neue Rollenbilder
Die Fragmentierung von Publikationen in Inhalte und diese Inhalte transportierende Dateiformate, ausführende Software, Datenbanken und Endgeräte ist jedoch nur ein Faktor des stattfindenden Paradigmenwechsels. Um zu verstehen, was dieser Prozesse für die Beteiligten bedeutet, muss man sich zunächst die klassische Rollenverteilung entlang der Wertschöpfungskette vergegenwärtigen:
- Autoren produzieren Inhalte.
- Verlage produzieren auf Grundlage dieser Inhalte Gebrauchsgüter in Form von Druckerzeugnissen und gestalten damit gleichzeitig das Nutzungserlebnis (in der Softwareentwicklung würde man hier von „user experience“ sprechen).
- Handel und Bibliotheken verschaffen Zugang zu diesen Gütern und produzieren ihrerseits ein Konsumerlebnis, wobei ein maßgebliches Qualitätskriterium für dieses Erlebnis eine Filterfunktion ist, also die Frage, inwieweit es gelingt, subjektiv (!) relevante Auswahlen an Inhalten zu präsentieren, sei es im Regal oder im Katalog.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Buchhandel und Bibliotheken ist, dass der Handel in der physischen Welt lediglich die Funktion eines Kanals hin zum Leser hat, Inhalte also lediglich durchschleust, selbst aber weder sammelt noch erschließt, was Aufgabe der Bibliotheken ist. Darüber hinaus existiert in der physischen Welt eine strikte Trennung zwischen der öffentlichen Sphäre des Zugangs zu sowie der privaten Sphäre der Rezeption von Inhalten.
In der digitalen Welt verändern sich die traditionelle Wertschöpfungskette und damit auch die Rollenverteilung gravierend. Die Software wird zum alles bestimmenden Faktor. Am deutlichsten merkt man das bei digitalen Zeitschriften-Abos, was direkt an das Selbstverständnis der Bibliotheken rührt: Ist eine Bibliothek noch eine Bibliothek, wenn sie gar kein „Buch-Behälter“ mehr ist, sondern das Sammeln, Erschließen und Zugänglich-Machen andere übernehmen? Die Bibliotheken zahlen lediglich dafür, dass andere ihre Aufgaben übernehmen – und damit zahlen sie letztlich auch mit dem eigenen (Über-) Leben.
Das Ende der Privatsphäre – and the end of the world as we know it
Aufgrund der mittlerweile in allen Bereichen etablierten Cloud-Services stehen elektronische Publikationen nicht mehr in heimischen Bücherregalen oder Bibliotheken, sondern in kommerziellen Serverfarmen, die neben elektronischen Publikationen massenhaft all jene Daten sammeln, die durch die Nutzung dieser Inhalte anfallen. Dies geschieht ganz automatisch. Wir erzeugen permanent Daten, ob wir uns dessen nun bewusst sind oder nicht.
Zum ersten Mal in der Geschichte sind wir mit Hilfe von Software in der Lage, nicht nur das kulturelle (Buch-) Wissen, sondern auch das kontextuelle und kommunikative Wissen der Menschheit nahezu lückenlos zu dokumentieren und auszuwerten (oder anders ausgedrückt: zu sammeln und zu erschließen). Ob dies immer freiwillig und in vollem Bewusstsein der zu melkenden „Datenkühe“ erfolgt, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Erst kürzlich stellte Rafael Ball, Leiter der ETH-Bibliothek in Zürich, in einem Interview mit der NZZ fest: „Die Bibliothek [heutiger Prägung ist] nicht der Träger der Lesekultur. Zweitens ist die Bibliothek auch nicht der Hort des Wissens. Die Bibliothek ist nur ein Hort von Büchern. […] das Wissen steckt in den Köpfen der Menschen, die Informationen verknüpfen. Bibliotheken sind nur Datenträger.“
Und genau hier liegt der entscheidende Unterschied zwischen analogen und digitalen Bibliotheken: Während analoge Bibliotheken immer nur Horte von Büchern bleiben, sind digitale Bibliotheken durchaus in der Lage, Informationen zu verknüpfen und Wissen zu generieren, da sie das Wissen ihrer Nutzer in sich aufsaugen. Durch die Sammlung von Nutzerdaten sowie die kollektive Nutzung digitaler Inhalte entsteht ein zusätzlicher Kontext, der sehr viel wertvoller ist als die Summe seiner einzelnen Teile.
Die Tatsache, dass einige wenige Konzerne bereits heute weite Teile der öffentlichen Grundversorgung mit digitalen Inhalten kontrollieren, stellt eine Bedrohung für eine demokratische Wissens- und Informationsgesellschaft dar. Wir laufen Gefahr, die Hoheit über unser wichtigstes Kulturgut zu verlieren und hinsichtlich der Versorgung mit digitalen Inhalten von jenen anhängig zu werden, welche die (systemrelevanten) Infrastrukturen betreiben.
Kommerzielle Anbieter usurpieren damit de facto den Auftrag der Bibliotheken. Gleichzeitig fällt jenen Anbietern eine Verantwortung zu, die sie als reine Wirtschaftsunternehmen nicht einlösen können.
Die Rolle des Autors in der digitalen Welt
Voraussetzung für die Teilnahme am öffentlichen Diskurs ist eine Veröffentlichung. In früheren Zeiten war dies ein extrem aufwändiges und teures Unterfangen, für das man einen kompletten Industrie- und Vertriebsapparat in Bewegung setzen musste, sodass man stets auch jemanden brauchte, der das erforderliche Kapital vorstreckte (oder vorlegte – daher etymologisch auch das deutsche Wort Verlag).
Inzwischen haben wir uns hin zu einer Wissens- und Informationsgesellschaft entwickelt, in der jeder Wissensarbeiter seine Produktionsmittel in Form seines Wissens selbst besitzt. Die erforderlichen Werkzeuge, das eigene Wissen produktiv zu machen, sind in der Regel frei verfügbar oder aber kostentechnisch vernachlässigbar. Wir brauchen dafür heute keinen Industriepark samt nachgelagerter Vertriebsorganisation mehr. Jeder kann mit Hilfe eines Rechners sowie der nötigen Software selbst publizieren.
Mike Shatzkin spricht in diesem Zusammenhang von einer „Atomisierung des Publizierens“ – das Veröffentlichen ist aus Perspektive der Autoren eine reine Funktion geworden und nicht länger die Domäne einer eigenen Verwertungsindustrie.
Man kann Autoren also nicht mehr per se das Bedürfnis nach einer Publikation bei einem Verlag unterstellen. Doch so erfreulich diese Entwicklung für die Teilhabe des Einzelnen am öffentlichen Diskurs theoretisch auch ist, so schwierig gestaltet sie sich in der Praxis.
Für wissenschaftliche Autoren sind Publikationen nicht nur die Eintrittskarte in die akademische Welt – ihre gesamte Karriere hängt von ihnen ab. Die harte Währung in dieser Welt ist Reputation, die sich aus Peer Review-Prozessen und bibliometrischen Verfahren zur Bestimmung des Impact Factors speist. Die Notenbanken dieser Währung sind private Kreditinstitute, die sich – und hier schließt sich der Kreis zur eingangs erwähnten Zeitschriftenkrise – diese Währung noch nach Belieben zusätzlich vergolden lassen.
Und wie weiter?
Unsere Kernaufgabe sowohl als Bibliotheken als auch als Buchbranche ist die Vermittlung von Inhalten, die immer mehr auf elektronischem Wege erfolgt. Das Problem ist, dass wir damit auch immer abhängiger von Technologien werden, die wir allenfalls anwenden, nicht aber selbst entwickeln.
In den guten alten Zeiten lag die Macht in den Händen derer, die lesen und schreiben konnten. In der digitalen Welt sind wir, die wir keine Programmiersprachen beherrschen, die Analphabeten. Und es reicht nicht, sich auf Dolmetscher zu verlassen. Wir müssen selbst Sprachkompetenz aufbauen, uns die Technologie aneignen, wenn wir unser Dasein nicht in analogen Reservaten fristen und unsere Expertise gegen Glasperlen eintauschen wollen.
Open Access in Form von reinen Repositorien (Dokumentenservern) kann insofern keine Lösung sein. Repositorien sind – siehe „storage clouds“ – isolierte Datenhalden ohne Funktion. Der Schlüssel liegt in der Anwendung, d.h. in der individuellen Nutzung von Inhalten durch den einzelnen Menschen.
Wir müssen insofern von den Bedürfnissen der einzelnen Mitglieder des Wissenschaftsbetriebs ausgehen und dafür sorgen, dass ein echter wissenschaftlicher Diskurs stattfinden kann, indem wir die einzelnen Teilnehmer vernetzen und ihnen die nötigen Kommunikationsmittel an die Hand geben. Gleichzeitig müssen wir einen verbindlichen gemeinsamen Referenzrahmen schaffen, der die Authentizität von Inhalten garantiert und damit auch eine uneingeschränkte Zitierfähigkeit ermöglicht, was auch das Thema Langzeitarchivierung beinhaltet.
Um noch einmal auf das weiter oben zitierte Interview mit Rafael Ball zurückzukommen: Ich stimme Herrn Ball zu, dass Bibliotheken in Zukunft nur dann eine Daseinsberechtigung haben, wenn sie ihr Geschäftsmodell ändern und neue Leistungen anbieten. Ich gehe auch mit seiner Sichtweise konform, wonach eine Bibliothek sowohl ein Informations- und Kommunikationszentrum sein sollte, das Zugriff auf elektronische Inhalte ermöglicht als auch ein Analysezentrum, das dabei hilft, die riesigen Mengen an Literatur nach relevanter Information zu durchsuchen.
Ich teile außerdem die in besagtem Interview geäußerte Sicht, dass es in Wissenschaftsbibliotheken wie der ETH darum gehen werde, Wissenschaftler zu beraten und zu unterstützen, insbesondere bei der Publikation von wissenschaftlichen Artikeln. Dies wäre meines Erachtens ein ganz zentraler Punkt und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die Bibliotheken ein gemeinsames System für die Publikation wissenschaftlicher Artikel auf die Beine stellen sollten, welches das aktuelle dysfunktionale System komplett ablöst. Mit einer Umschichtung der Mittel weg von den bis dato etablierten Bundle-Abos hin in eine eigene Software-Entwicklung wäre dies finanzierbar. Darüber hinaus würden wieder Etats für Monographien und Lehrbücher frei.
Die Synthese von analog und digital
Stellen Sie sich vor, die Bibliotheken dieser Welt würden eine gemeinsame digitale Universabibliothek aufbauen – mit einem gemeinsamen Bestand, der von den individuell an dieses Netzwerk angeschlossenen Bibliotheken aufgebaut, erschlossen und gepflegt wird. Jede Bibliothek würde ihren Teil zum Gesamtbestand beitragen und gleichzeitig mit der Sicherung der eigenen Datenbestände auch einen Teil der Sicherung des Gesamtbestandes übernehmen. Ein echtes Bibliotheks- bzw. Bibliotheken-Netzwerk.
Bildlich gesprochen wäre jede Bibliothek eine „Gehirnzelle“, die über Synapsen mit den anderen Bibliotheken in einem großen „zentralen Nervensystem“ verbunden ist. Auf diesem Netzwerk würde ein weiteres Netzwerk für die Nutzer aufsetzen, das diese in die Lage versetzt, sich untereinander auszutauschen, über Texte miteinander zu kommunizieren.
Entsprechend indizierte „Mastercopies“ bilden einen verbindlichen, zitierfähigen Referenzrahmen und sammeln sämtliche Informationen um deren Nutzung herum: Rezensionen / Bewertungen (z.B. in Peer-Review-Verfahren), nutzergenerierte Inhalte, die sich auf diese Quellen beziehen, wie Anmerkungen, Kommentare, Markierungen, Diskussionsbeiträge, etc. – es entstünde so ein lebendiges Gedächtnis der Menschheit, das kontinuierlich wächst, neue Synapsen bildet, Informationen ordnet, abrufbar macht und in einen größeren Kontext einbettet.
Eine solche globale Universalbibliothek würde von einer möglichst hohen Diversität der an sie angeschlossenen Institutionen profitieren, die sich ganz auf ihre lokalen oder fachlichen Spezialisierungen konzentrieren könnten und in der Aufarbeitung und Erschließung ihrer historischen Bestände, Nachlässe und Sammlungen einen originären Beitrag leisten.
Während die gemeinsame Online-Präsenz also die zentrale Anlaufstelle für die globale Community ist, sind die einzelnen Bibliotheken die Anlaufstellen für ihre lokalen Communities, die an sie angeschlossenen Institute bzw. Fachleute. In einem solchen globalen Netzwerk könnten die einzelnen Bibliotheken folgende Aufgaben haben bzw. Angebote stellen:
- Kommunikations- und Informationszentren mit Leseplätzen, Arbeitsplätzen, Treffpunkten und Tagungsräumen – oder modern ausgedrückt „Coworking Spaces“ für Wissensarbeiter
- Unterstützung wissenschaftlicher Projekte durch Infrastruktur
- Beratung und Unterstützung wissenschaftlicher ebenso wie journalistischer Publikationen (Aufsätze / Zeitschriften)
- Betrieb von Rechenzentren, auf deren Servern ein Teil der globalen Bibliothek betrieben wird, inklusive Backups und Langzeitarchivierung
- Bewahrung historischer Bestände, Nachlässe und/oder spezialisierter Sammlungen
- Digitalisierung, Aufarbeitung und Erschließung historischer Bestände, Nachlässe und/oder spezialisierter Sammlungen
- Leseförderung durch neue Zugänge zu Wissen und Literatur
Vor allem aber sollte ein solches System kein isolierter Elfenbeinturm, sondern tief in der Gesellschaft verwurzelt sein – offen zugänglich für alle. Wobei „offen“ nicht zwangsläufig kostenlos bedeuten muss oder gar soll. Natürlich müssen wir uns auch Gedanken über Finanzierbarkeit und Erlösmodelle machen, insbesondere wenn es um Monographien, Lehrbücher oder belletristische Inhalte auf Publikumsseite geht, die noch einmal ganz anderen Regeln folgen als der Wissenschaftsbetrieb.
Ja, aber …
Mir ist völlig bewusst, dass es eine Unzahl an Abers gibt und ich gebe unumwunden zu, dass auch ich mehr Fragen als Antworten habe. Nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, wenn dieser Essay den Anstoß zu einer konstruktiven Diskussion geben und vielleicht sogar einen Prozess ins Rollen bringen könnte, an dessen Ende eine gemeinsame Plattform steht, welche die Kräfte aller Beteiligten bündelt.
Und als Nutzer wünsche ich mir eine Plattform, die mir volle Datensouveränität bietet, die mich also selbst entscheiden lässt, was von meinen Daten zu welchem Zweck gesammelt, gespeichert und verarbeitet wird – und dass jener Teil meiner Daten, der für eine öffentliche Nutzung bestimmt ist, auch tatsächlich der Allgemeinheit zugutekommt und nicht in der Privatschatulle eines internationalen Konzerns verschwindet.
Der Weg dahin ich sicherlich alles andere als einfach. Es wird auch keine Abkürzungen geben. Man wird zwischenzeitlich stolpern, sich eine blutige Nase holen oder auch ganz in die Irre gehen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns auf den Weg machen, den ersten Schritt gehen. Am Besten gemeinsam. Stehenbleiben ist keine Option.
Volker Oppmann, Gründer und CEO log.os GmbH & Co. KG. Oppmann studierte Germanistik und Skandinavistik in Bonn und Bergen. Erste Verlagserfahrung sammelte er 2002 bei Rogner & Bernhard in Hamburg und gründete anschließend den Berliner Independent-Verlag ONKEL & ONKEL. Mit textunes war er erster deutscher Anbieter von eBook-Apps und war von 2011 bis zum Launch des Tolino im März 2013 verantwortlich für den Digitalbereich bei Thalia. Seit 2013 arbeitet er im Bereich des Entrepreneurial Designs und Managements bei log.os.
Erstveröffentlichung: Zeitschrift für Bibliothekskultur (1) 2016, S. 33-41. ISSN: 2296-0597. Zweitveröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Autors.










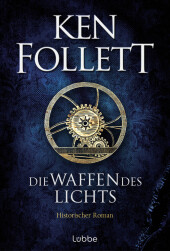
Kommentar hinterlassen zu "Volker Oppmann: Die Digitalisierung des Wissens – oder: Haben Bibliotheken und wissenschaftliches Publizieren eine gemeinsame Zukunft?"