Smartphones spielen nicht nur im E-Commerce, sondern auch beim Medien-Konsum eine immer größere Rolle. Auf der Frankfurter Buchmesse widmet sich Christiane Frohmann im „Orbanism Space“ – bei dem buchreport Medienpartner ist – gemeinsam mit Sascha Lobo dem Smartphone als „Über-Objekt“. Vorab gibt die Digitalverlegerin einen Ausblick.
Was und wann lesen Sie auf dem Smartphone?
 Ich lese überwiegend Online-Texte auf dem Smartphone, also Tweets, Blog-Posts, Artikel. E-Books lese ich meist auf dem Laptop, weil ich gern direkt beim Lesen Textauszüge für eigene Arbeiten sichere. Die Ausnahme bilden E-Books, die extra für Smartphones gemacht sind: Da entstehen gerade spannende neue Erzählformen. Einen Reader benutze ich nur noch auf mehrwöchigen Reisen.
Ich lese überwiegend Online-Texte auf dem Smartphone, also Tweets, Blog-Posts, Artikel. E-Books lese ich meist auf dem Laptop, weil ich gern direkt beim Lesen Textauszüge für eigene Arbeiten sichere. Die Ausnahme bilden E-Books, die extra für Smartphones gemacht sind: Da entstehen gerade spannende neue Erzählformen. Einen Reader benutze ich nur noch auf mehrwöchigen Reisen.Sie nähern sich dem Smartphone-Phänomen aus unterschiedlichen Diskursrichtungen, welche Dimension interessiert Sie derzeit am stärksten?
Mich persönlich interessiert das Smartphone vor allem psychologisch und kulturwissenschaftlich als „Über-Ding“ und Ich-Erweiterung. Als aktuell wichtigstes Werkzeug der Selbst-Performance, als Medium zum „Selfie-Publishing“. Als solches bewegt es sich irgendwo zwischen externem Gedächtnis und Personal Trainer. Es fasziniert mich, wie das Smartphone milieuübergreifend Bedeutung hat, wie es Grenzen verwischt. Natürlich zombiefiziert es Menschen auch, das sieht man, wenn draußen ganze Gruppen mit Blick auf den Screen an einem vorbeiwanken. Aber das wird sich vermutlich bald regulieren; man beobachtet um sich herum und auch an sich selbst ja schon aktive Bestrebungen, sich zeitweise bewusst zu entvirtualisieren. Die Faszination lässt also allmählich nach bzw. man merkt, dass es teilweise doch eher Suchtverhalten ist und hält gegen.
Besonders in den USA zeichnet sich eine deutliche Verlagerungvon E-Readern und Tablets hin zu Smartphones ab. Was bedeutet das für die Buchbranche?
Ich glaube schon lange nicht mehr an Reader, siehe ein Tweet vom September 2014: „E-Reader werden bald so anachronistisch sein, wie es der frühe kleine iPod ohne Titelanzeige jetzt schon ist.“ Niemand schleppt gern mehr Geräte als nötig durch die Gegend, und Smartphones sind mittlerweile größer, also lesefreundlicher und Laptops kleiner, also noch rumtragefreundlicher geworden. Für die „Buchbranche“ gilt weiterhin, dass sie sich auf ihre eigentlichen Kompetenzen besinnen und gut lektorierte, schön gestaltete Bücher machen sollte: Die sind weiterhin gefragt und das wird auch noch lange so bleiben. Jetzt ist wirklich „Die Andere Bibliothek“ gefragt, quer durch die Traditionsverlage. Sollten jetzt gerade alle denken, ganz schnell Smartphone-Literatur machen zu müssen, würde ich abraten: Wer das nicht aus dem Netz und dessen Dynamik schöpft, scheitert. Um die neuen digitalen Formen zu bedienen, dafür muss man sich als klassischer Verlag Leute holen, die originär Zugang dazu haben, alles andere führt ins Leere – siehe etliche wieder zugemachte Digitalabteilungen.
Smartphone-Leser schränken nach Statistiken deutlich ihr Lesepensum ein, hinzu kommt, dass eine konzentrierte Lektüre längerer Texte durch die gesteigerte Ablenkbarkeit schwierig ist – was muss die Buchbranche tun?
Das ist teilweise wahr, teilweise aber auch ein Wahrnehmungsproblem. Man liest nicht weniger, sondern weniger bewusst und sprunghafter. Menschen lesen faktisch mehr als je zuvor. In Games, im Chat, überall ist Text. Lesen gehört allerdings nicht mehr allein den Buchmenschen, es ist jetzt weniger exklusiv. Das tut Distinktionswächtern weh, aber so ist es nun mal. Die Frage ist weniger, wie man Inhalte anpasst – das ist wieder das leidige Formatdenken –, sondern, wie sehr man sich auf die neuen Inhalte und Formen einlässt, ob man Zugang dazu findet und das in die eigene Arbeit einbindet. Klar, können auch klassische Verlage jetzt kürzer getaktete Texte veröffentlichen: auf funky gebürstete Fortsetzungsromane, Novellen etc., aber damit hinken sie den originären ästhetischen Entwicklungen immer schon hinterher.
Wie müssen Verlage stattdessen ihre Inhalte anpassen?
Verlage müssen nicht ihre Inhalte, sondern ihre Performance anpassen, entweder, indem sie wieder exklusiv machen, was sie vollständig überblicken und beherrschen oder, indem sie sich Mitarbeiter suchen, die solche Fragen nicht stellen würden.
Vielleicht liegt da auch die eigentliche Gefahr für die Buchbranche, dass man sein Fähnchen dauernd nach dem Wind dreht, um es allen Recht zu machen und nicht den Anschluss zu verpassen. Man könnte als Verlag ja auch ganz anders auftreten und sagen: Nehmt euch die Zeit für den dicken Roman. Es lohnt sich, denn wir haben das Buch schön gestaltet, und ihr werdet keine windschiefe Metapher und keinen Tippfehler darin finden. Seid keine ferngesteuerten Consumer, seid bewusste Leser. – Ich persönlich bin extrem nah an den neuen literarischen Formen, und trotzdem würde ich es lieben, wenn man mir Bücher im Jahr 2015 so verkaufen würde: ohne Startup- oder Börsennotiertes-Unternehmen-Gefühl. Warum können Verlage nicht einfach gute Verlage sein, statt sich in gesichtslose Medienhäuser zu verwandeln? Austauschbarkeit ist keine gute Überlebensstrategie.










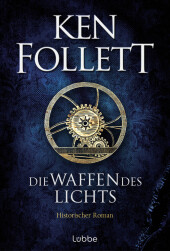
Kommentar hinterlassen zu "Wichtigstes Werkzeug der Selbst-Performance"